Neulich, sagt Hedwig T., habe sie tatsächlich Freude empfunden. Freude! „Das ist kein Gefühl, das ich aus meiner Kindheit kenne“, sagt sie, noch immer erstaunt darüber.
Was war es denn, was die Freude bei ihr auslöste?
„Wir haben gemeinsam musiziert“, sagt Hedwig T. Sie blickt ihren Mann an, der sie wie immer zu unserem Treffen begleitet hat, beide lächeln.
I.
Vor zweieinhalb Jahren saßen wir schon mal hier in dem Nürnberger Altstadtcafé. Hedwig T., 55 Jahre alt, hat sich verändert seitdem, und ich frage sie vorsichtig, woran es wohl liegen könnte. Eine neue Brille vielleicht? Sie lacht, und ich sehe es selbst: Die Wut ist aus ihrem Gesicht gewichen.
Als wir uns im Sommer 2022 trafen, hatte Hedwig T. gerade Post aus dem Bistum Münster bekommen, die sie „fassungslos“ machte, „sprachlos“. Der Brief war mehrere Seiten lang, aber im Grunde ließ sich der Inhalt in einem einzigen Satz zusammenfassen: Wir glauben Ihnen nicht.
Ein Jahr zuvor hatte Hedwig T. beim Bistum einen sexuellen Missbrauch angezeigt: Der Pfarrer der Kirchengemeinde, in der sie aufwuchs, habe sie bei ihrer ersten Beichte vor der Erstkommunion missbraucht. Wie so oft bei Fällen sexuellen Missbrauchs gab es keine Zeugen und keine Beweise; wie so oft bei Betroffenen sexuellen Missbrauchs hatte Hedwig T., damals acht Jahre alt, keine Erinnerungen an die Tat selbst. Sie erinnerte sich nur an das Davor und Danach, vor allem an die Worte ihrer inzwischen verstorbenen Mutter, als sie ihr abends ihre Verletzungen zeigte: „Über so etwas musst du für immer schweigen!“ Hedwig T. schwieg 44 Jahre lang, erst dann wagte sie es, zu sprechen.
Das Bistum reagierte auf die Anzeige gemäß der vom Bischof erlassenen „Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger“. Es erstattete Strafanzeige und benannte einen sogenannten Voruntersuchungsführer, einen pensionierten Kriminalkommissar. Als die Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen Verjährung einstellte, begann der Voruntersuchungsführer mit seinen Ermittlungen.
Im Sommer 2022 hatte der Voruntersuchungsführer seinen Bericht abgeschlossen, und Hedwig T. saß in dem Altstadtcafé und zitierte kopfschüttelnd seine Worte, die ihr das Bistum geschickt hatte: „Die Äußerungen von Frau T. deuten stark auf eine Fiktion hin“! „Bloße Vermutungen“! „Fiktive Vorstellungen, die sie für Erinnerung hält“! „Nicht glaubwürdig“!
Es war unser letztes Treffen, bevor wir die Geschichte von Hedwig T. im Magazin des WEISSEN RINGS veröffentlichten:
II.
44 Jahre hatte es gedauert, bis Hedwig T. ihren Fall erzählen konnte. Und ausgerechnet die katholische Kirche, errichtet auf Glauben, sagte ihr: Wir glauben das nicht? Hedwig T. legte beim Bistum Beschwerde ein.
Die Sache mit der Beschwerde ist kompliziert. Das Kirchenrecht kennt keine Rechtsmittel wie Berufung oder Revision, es sieht nicht mal eine Akteneinsicht für Betroffene vor. Hedwig T. beschwerte sich über etwas, das sie eigentlich nicht einmal kennen dürfte. Der Interventionsbeauftragte des Bistums Münster, Peter Frings, hatte ihr den Bericht des Voruntersuchungsführers eigenmächtig zukommen lassen.
Frings, 66 Jahre alt und von Beruf Rechtsanwalt, hat das Amt als Interventionsbeauftragter mittlerweile abgegeben. Auf Nachfrage äußert er sich in einem Brief frei und ausführlich zu den damaligen Vorgängen. Es habe ihn „seinerzeit schon gestört“, dass der Voruntersuchungsführer seinen Bericht ausschließlich nach Aktenlage verfasste, ohne mit der Betroffenen oder mit dem beschuldigten Pfarrer, damals 93 Jahre alt, gesprochen zu haben. Die fehlende Akteneinsichtsmöglichkeit für die Betroffene habe seinem Rechtsempfinden „sehr stark widersprochen“, schreibt Frings: „Eine kirchliche Entscheidung würde möglicherweise auf der Basis von unvollständigen Voruntersuchungen getroffen.“ Vielleicht habe er sich über kirchliches Recht hinweggesetzt, „aber damit kann ich gut leben“.
Frings legte die Beschwerde von Hedwig T. dem Voruntersuchungsführer vor. Der sah keinen Anlass, eine erneute Untersuchung anzustellen.
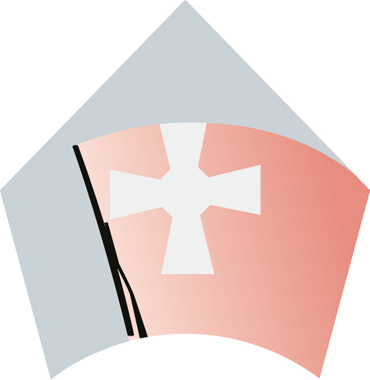
Gemäß der bischöflichen „Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger“ war der Fall Hedwig T. damit abgeschlossen. Für Hedwig T. jedoch nicht. Wut, sagt sie heute, kann ein Motor sein. Als sie 2023 erfuhr, dass der Voruntersuchungsführer in den Ruhestand gegangen war, bat sie Peter Frings, ihren Fall doch seiner Nachfolgerin vorzulegen. Womöglich setzte sich Frings zum zweiten Mal über kirchliches Recht hinweg, als er der Bitte nachkam.
Die neue Voruntersuchungsführerin traf sich mit Hedwig T. in Nürnberg, sie sprach mit dem Anwalt des beschuldigten Pfarrers (der die Tat abstritt), sie ermittelte zu nachprüfbaren Fakten wie Tatort, Tatzeit, Tatumständen. So kam sie zu einer anderen Bewertung als ihr Vorgänger, in ihrem Bericht heißt es nun: Die äußeren Umstände des von Frau T. geschilderten sexuellen Missbrauchs seien „unstrittig“, ihre Erinnerungslücken aufgrund der erlittenen Traumatisierung „nachvollziehbar“. Von „Fiktion“ könne nur die Rede sein, wenn der behauptete Ablauf so nicht möglich gewesen wäre, „das kann ich hier nicht sehen“. Die Voruntersuchungsführerin schloss ihren Bericht mit dem Satz: „Was tatsächlich passiert ist, kann heute nicht mehr aufgeklärt werden. Beide Versionen sind theoretisch möglich.“
Peter Frings schickte Hedwig T. auch diesen Bericht zu. Und er fragte sie, ob er den neuen Bericht der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) in Bonn zukommen lassen dürfe. Die UKA entscheidet zentral über Entschädigungszahlungen für Missbrauchsopfer der katholischen Kirche; allein 2023 bewilligte sie insgesamt 16,1 Millionen Euro für Betroffene.
Die UKA prüfte den Fall, sie erkannte Hedwig T. als Opfer an und sprach ihr eine Entschädigung zu – „angesichts der geschilderten Taten sowie des Umgangs mit dem Fall durch verantwortliche Personen“. Über den hinteren Teil des Satzes sagt Hedwig T.: „Das hat mich extrem berührt.“ Da steht es endlich: Es war falsch vom Bistum, ihre Schilderung als „Fiktion“ zu bezeichnen, es war unsensibel, es war traumatisierend.
„Die Anerkennung des Leids hat mir ein Stück meiner Identität zurückgegeben“, sagt sie im Altstadtcafé.
III.
Das Bistum Münster hat Lehren aus dem Fall Hedwig T. gezogen:
Es gibt nicht länger nur einen Voruntersuchungsführer, es gibt inzwischen drei: zwei ehemalige Polizeikräfte, einen früheren Strafrichter. Eine Frau, zwei Männer.
Die Voruntersuchungsführer und die Voruntersuchungsführerin treffen sich regelmäßig zu Fallbesprechungen, auch Konferenzen mit den Interventionsbeauftragten gibt es. „Es hilft uns sehr, ein solches Netzwerk nutzen zu können“, sagt Stephan Baumers, einer der beiden aktuellen Interventionsbeauftragten.
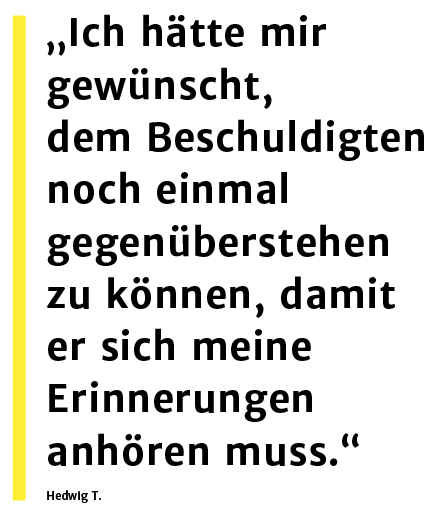
Der Voruntersuchungsführer/die Voruntersuchungsführerin entscheidet nicht nach Aktenlage, sondern sucht das Gespräch mit Betroffenen und Beschuldigten. „Wir scheuen dafür keinen Weg“, verspricht Stephan Baumers, „wir wollen es den Betroffenen so einfach wie möglich machen.“
Das Bistum hat den „Ablauf einer Voruntersuchung“ schriftlich festgehalten. „Zentraler Punkt“ ist dabei für Peter Frings, den ehemaligen Interventionsbeauftragten, die neue „Ziffer 4“: „Sowohl die betroffene Person als auch die beschuldigte Person können nach Abschluss des Voruntersuchungsverfahrens Einsicht in die Originalakte der Voruntersuchung nehmen.“
IV.
Eine Akte kann man schließen, die dazugehörigen Erinnerungen und Gefühle aber nicht.
Da ist das Gefühl der gestohlenen Kindheit, sagt Hedwig T.: Die Erinnerung an eine Erstkommunion, die für sie mit Trauer, Wut und Scham verbunden ist. Das Schweigen danach, die Isolation.
Da ist das Gefühl der Angst. Der beschuldigte Pfarrer hatte sich 2022 einen aggressiven Anwalt genommen, der Hedwig T. eine „krankhafte Störung“ unterstellte. Sollte sie an ihren „Behauptungen“ festhalten, lasse sich „die Einleitung zivil- und strafrechtlicher Schritte nicht vermeiden“, drohte er.
Da ist das Gefühl des Bedauerns. Der Pfarrer ist im vergangenen Jahr verstorben, er wurde 94 Jahre alt. „Ich hätte mir gewünscht, dem Beschuldigten noch einmal gegenüberstehen zu können, damit er sich meine Erinnerungen anhören muss.“
Hedwig T. legt immer noch großen Wert auf Anonymität, auch dieser Text soll nicht zu viele Details über sie, ihre Familie und ihre alte Kirchengemeinde schildern. 2022 hat sie einen Karton mit Magazinen vom WEISSEN RING angefordert, sie wollte sie in ihrer Heimatgemeinde auslegen. Die Hefte liegen noch bei ihr zu Hause, es hat bislang nicht gepasst für sie.
Aber, sagt Hedwig T., da ist auch ein Gefühl von Stolz: Sie hat das Schweigen gebrochen. Sie ist, mit ihrem Mann an ihrer Seite, einen langen Weg gegangen und hat Rückschläge überstanden. Heute habe sie das Gefühl, „wieder im Leben zu sein“, wie sie sagt.
Hedwig T. ist gelernte Krankenschwester, lange konnte sie den Beruf wegen der Traumatisierung nicht ausüben. Seit einigen Monaten arbeitet sie wieder, sagt sie, „auch das macht mich stolz“. Sie lächelt.
Karsten Krogmann





