Organisieren, organisieren. Jürgen Lüth benutzt das Wort häufig. Es passt aber auch gut zu dem, was er tut. Denn Jürgen Lüth ist einer, der dafür sorgt, dass die Dinge funktionieren. Dass Menschen bekommen, was sie brauchen – um gut zu arbeiten und um gern zu arbeiten. Wie ein fordernder und zugleich sorgender Familienvater, der weiß, dass Leistung Wohlbefinden braucht, Zusammenhalt und Anerkennung. Der viel verlangt, aber auch viel gibt.
Das Landesbüro des WEISSEN RINGS in Potsdam, Brandenburg, zum Beispiel: liegt in einer hübschen, zentralen Wohngegend, hat helle Räume, Einzelarbeitsplätze und ein Konferenzzimmer. Lüth, groß, schlank, im adretten weißen Rollkragenpulli, führt herum. „Seit unserer Gründung sind wir zweimal umgezogen, bis wir diese Adresse gefunden haben. Den Büromöbelhersteller konnte ich überzeugen, uns die gesamte Ausstattung zu spenden.“
Lüth bittet Platz zu nehmen, neben einem Schreibtisch, der schon nicht mehr seiner ist, denn der brandenburgische Noch-Landesvorsitzende wird sich im Mai in den Ruhestand verabschieden. Mit 75. Er schwenkt langsam den Hagebuttenteebeutel in seiner Tasse. „Bald kommt das dritte Urenkelkind. Da ist es wohl Zeit, sich der eigenen Familie zu widmen.“ Freut er sich auf die Freizeit? „Man wird sich vielleicht noch neue Aufgaben suchen müssen“, meint er. „Vielleicht ein Buch schreiben …?“ Er winkt ab: Ist auch mal gut.
„Ich bin einer, der ein paar Nächte durcharbeiten kann“
An Aufgaben mangelte es bislang nie. Lüth scheint sie schneller zu sehen als andere Menschen und sich dann auch gleich reinzustürzen. Eigentlich wollte er nach der zehnten Klasse Förster werden, „aber es gab zu wenige Reviere“. Und wer weiß, wie diesem Netzwerker die einsame Arbeit im Wald bekommen wäre? Stattdessen machte er Abitur, wurde Diplom-Agrotechniker und leitete schließlich ein Trockenwerk in Herzberg, Brandenburg. Gearbeitet wurde in drei Schichten, rund um die Uhr, und auch Lüth arbeitete oft nachts – oder er fuhr nach Feierabend über Land, um nach seltenen, aber dringend benötigten Ersatzteilen zu suchen. Von zu Hause aus konnte er sehen, ob die Trocknungsanlage für Mais, Gras und Zuckerrüben lief – „ich fühlte mich 24 Stunden gebunden“. Und hat er auch mal geschlafen? „Ich bin einer, der ein paar Nächte durcharbeiten kann, wenn es drauf ankommt.“ Auch das sagt er öfter.
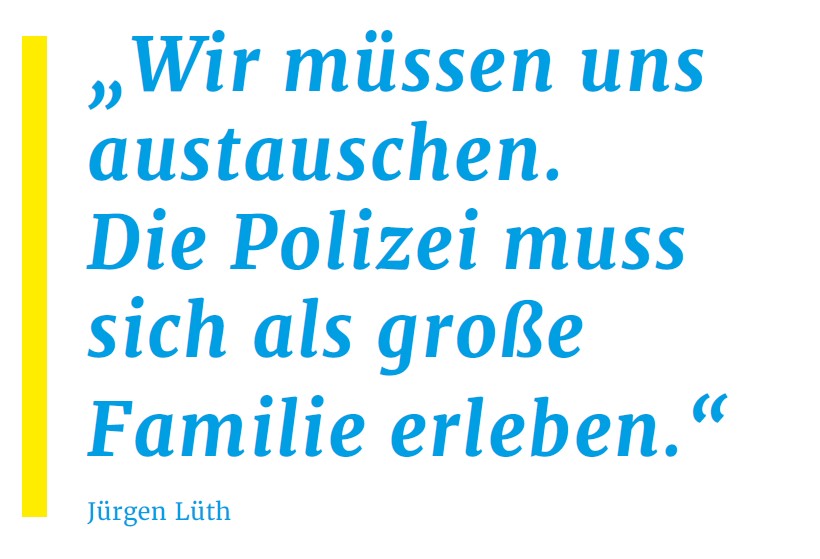
Weil jeder Betrieb in der DDR ab einer gewissen Größe eine paramilitärische „Kampfgruppe der Arbeiterklasse“ für die Zivilverteilung bilden sollte, meldete sich Lüth als Freiwilliger bei der Verkehrspolizei. Ein smarter Zug: Damit war die verfügbare Belegschaft zu klein für eine Kampfgruppe, sie konnte unbehelligt ihrer Arbeit nachgehen. Und Lüth machte der Nebenjob Spaß: „Trotz der Schreckensseiten, die die Aufnahme von Unfällen haben kann.“
Er wäre schon nach dem Studium gern zur Polizei gegangen, war aber kein SED-Mitglied, sondern in der Bauernpartei. Als diese 1990 mit der CDU fusionierte, zog Lüth per Direktmandat für die CDU in den Potsdamer Landtag ein. Er war bekannt, ihn freute das Vertrauen, das die Menschen ihm entgegenbrachten, „und so habe ich mich mit ganzer Kraft und voller Begeisterung an die Arbeit gemacht“. Seine Stimme bebt fast, die Begeisterung ist immer noch da. 1992 wurde ihm der Posten des Polizeipräsidenten von Cottbus angeboten. Eine große Aufgabe. Von den 3.000 Angestellten blieben im Zuge der Umstrukturierung nur 1.500, mit denen musste er fortan „Sicherheit organisieren“. Gleichzeitig musste er sie auf etwaige Stasi-Vergangenheit überprüfen und in ein neues Rechtssystem überführen. „Man muss mit den Menschen sprechen, sie mitnehmen“, sagt er. „Und man muss jede Gelegenheit nutzen, um Wertschätzungen auszusprechen.“ An Unfallstellen habe er manches Mal angehalten und den Kollegen für ihren Einsatz gedankt.
Der Netzwerker ist Feuer und Flamme
Unterstützer fand Lüth dabei in Polizei-Führungskräften der alten Bundesrepublik, die ihm auch vom WEISSEN RING und den Aufgaben des Vereins erzählten. Als er 1993 vom damaligen Bundesvorsitzenden des Vereins, Herbert Becker, Besuch erhielt und zur Mitarbeit eingeladen wurde, war er wieder Feuer und Flamme. Lüth trat in den Bundesvorstand ein, seit 1996 ist er Landesvorsitzender. Sein erstes großes Anliegen war es, die Interessen der Menschen aus den neuen Bundesländern zu vertreten: „Die Leute hatten Jahrzehnte DDR-Politik erlebt. Viele waren durch die politischen Neuerungen eingeschüchtert. Wir mussten Vertrauen für unseren Verein schaffen!“ Lüth führte zahllose persönliche Gespräche; er fand Verbündete in den Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und Matthias Platzeck, und er schmiedete Partnerschaften mit Vertretern von Kommunen, Sportvereinen und Kirchen. Er organisierte Medientermine und öffentliche Events, um den WEISSEN RING bekannter zu machen, und er sorgte dafür, dass jeder neue Außenstellenleiter öffentlichkeitswirksam in sein Amt eingeführt wurde. Landräte, Bürgermeister und die Präventionsbeauftragten der Polizei waren dabei oft an seiner Seite.
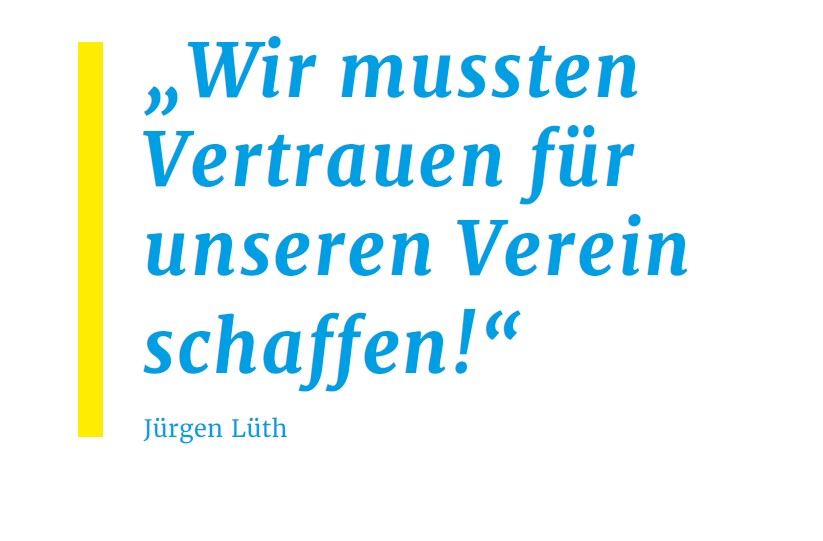
Lange Zeit vergeblich kämpfte Lüth um den Aufbau von Trauma-Ambulanzen in Brandenburg. Dass es keine gab, ärgerte ihn sehr. Menschen, die zum Opfer von Gewalt und anderen Verbrechen wurden, brauchen psychologische Betreuung, sofort, selbst wenn sie recht stabil wirken. Denn posttraumatische Belastungsstörungen können auch später auftreten und lange wirken. Erst seit 2021 schreibt das Bundesgesetz vor, dass Trauma-Ambulanzen überall bereitstehen müssen.
Womöglich war es ihm auch deshalb ein Bedürfnis, selbst Opfer zu beraten und ihnen beizustehen, auch wenn dies nicht zu den Aufgaben eines Landesvorsitzenden gehört. Im Fall Ulrike B. zum Beispiel, der ihm sehr naheging. 2001 war die Zwölfjährige aus Eberswalde entführt, missbraucht und ermordet worden. Er sprach mit den Eltern, arbeitete mit im Team der Trauerbewältigung – „das heißt, viel Zeit mitbringen, zuhören können. Auch mal eine Hand halten.“
Zusammenhalt. Den braucht es nicht nur in solch entsetzlichen Einzelfällen, die ganze Gesellschaft benötigt ihn. Lüth sah mit Sorge, wie sich die festen Bindungen auflösten, die er zu DDR-Zeiten schätzte. An die Stelle enger Netze traten Vereinzelung und Wegschauen, gleichzeitig brachen Hass und Gewalt hervor. Die rechtsextremen Krawalle in Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda erlebte er als Polizeipräsident Anfang der Neunziger – auch Cottbus war da in Alarmbereitschaft.
Als gelte es, sich dieser Entwicklung mit aller Kraft entgegenzustemmen, organisierte Lüth in den folgenden Jahren unermüdlich: das bürgerliche Miteinander im Freundeskreis für Lübben, den er gleich nach der Wende mitgegründet hatte. Die Arbeit der Deutschen Gesellschaft, dem überparteilichen Bürgerverein zur Förderung politischer, kultureller und sozialer Beziehungen in Deutschland und Europa, in dem er den Vorstandsposten von Angela Merkel übernahm. Und als Mitglied den Sicherheitsausschuss des Brandenburger Landesfußballverbands. Bis heute ist er Sicherheitsbeauftragter beim FC Energie Cottbus, der zu Erstliga-Zeiten bis zu 22.000 Fans in sein Stadion zog, darunter auch immer Hooligans und Neonazis. Hat er mal die Nerven verloren, wenn es hoch herging? „Nein“, sagt Lüth. Doch ein Böller habe ihm mal schwer den Fuß verletzt.
Immer alles richtig gemacht?
Ist er selbst Cottbus-Fan? „Ich bin überhaupt kein Fußballfan!“ Er singt auch nicht, und doch hat er Brandenburgs Polizeichor gegründet. Er musiziert nicht, eine Polizeiorchester-Parade hat er dennoch ausgerichtet. Und obwohl er auch kein Radsportler ist, organisiert er seit mehr als 25 Jahren Touren für Polizisten, Bürgermeister, Staatsanwälte aus verschiedenen Ländern, unter dem Motto „Wir radeln für Völkerverständigung“. Warum das alles? Freude bereiten, Zusammenhalt fördern. „Wir müssen uns austauschen. Die Polizei muss sich als große Familie erleben.“
Im März 2019 wurde ihm für seine Verdienste beim WEISSEN RING und in den anderen Ehrenämtern das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Ist er stolz auf das, was er erreicht hat? „Ja“, sagt Lüth mit fester Stimme. Und die eigene Familie, wo blieb die bei all dem Engagement? Die, meint er nachdenklich, musste wohl zu oft ohne ihn auskommen. „Vielleicht hat man da doch nicht immer alles richtig gemacht.“
Jetzt kommt die Zeit, das zu ändern. Auch wenn die Sorge um die Gesellschaft ihn wohl niemals loslassen wird. Brutalität nimmt weiter zu, weltweit in Form von Kriegstreiberei und nationalistischem Machthunger. Und hinter mancher Wohnungstür als häusliche Gewalt. Übergriffe auf Polizistinnen, Polizisten und andere Menschen in Uniform werden immer aggressiver. Gleichzeitig sind Zeugen weniger bereit, einzugreifen. Die Angst der Zeugen kann er ein Stück weit nachvollziehen: „Die Menschen fürchten sich vor Rache.“ Er kennt sie selbst, die anonymen Gewaltandrohungen, die Menschen erhalten, die sich engagieren. Hat er selbst auch Angst? „Nein“, sagt Lüth. „Man gibt ja immer sein Bestes“, sagt er. „Trotzdem können wir nicht verhindern, dass manche Menschen Böses tun.“
Hiltrud Bontrup





