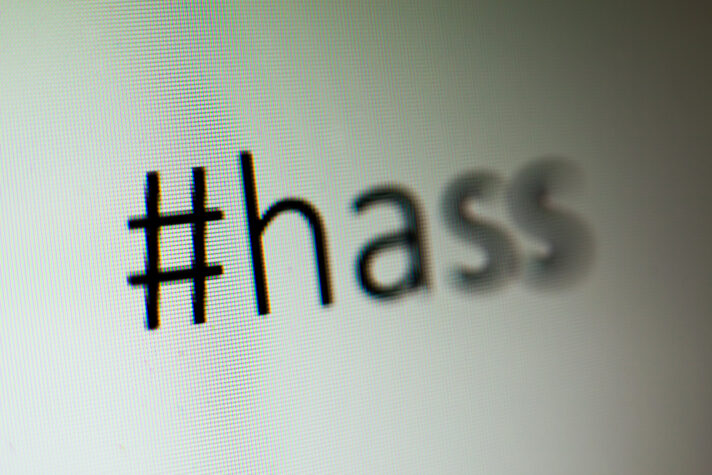Wenn Sie Ihrem Kind einen Verbrecher beschreiben sollten, wie sähe der wohl aus?
Ich weiß, dass es den „typischen“ Verbrecher gar nicht gibt. Aber ich habe einen fünfjährigen Sohn, der schon mal von Einbrechern spricht. Ihm schwebt dabei wahrscheinlich eine dunkle Gestalt vor, sicherlich nicht jemand, der mit Schlips und Kragen oder im Frack daherkommt. Speziell bei Verbrechen wie Einbruch, Diebstahl oder Raub, bei denen es um Geldwerte geht, scheint es ja erst einmal naheliegend, dass jemand zu kriminellen Methoden greift, der Geld braucht, weil er keins oder wenig hat.
Zu dem Bild von der dunklen, ärmlichen Gestalt als Verbrecher gehört zumeist auch der Wohlhabende als Opfer. Ist es in Wirklichkeit nicht so, dass arme Menschen viel häufiger Opfer von Kriminalität werden als reiche Menschen?
Täter und Opfer gehören meistens derselben Schicht an. Dabei kommt es auf die Deliktform an, von der wir sprechen. In den Köpfen der Menschen findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Täter werden gemeinhin eher in der Unterschicht vermutet, das Opfer eher in der Mittel-oder Oberschicht. Das ist sicher oft umgekehrt. Arme werden häufiger ausgenutzt. Unterbezahlung, Dumpinglöhne, Unterschreitung des Mindestlohns bei ausgebeuteten Werksvertragsarbeitern etwa in der Fleischindustrie, denen für schlechte Unterkünfte auch noch viel Geld vom kargen Lohn abgezogen wird – das ist kriminell. Aber diese Form der „Weiße- Kragen-Kriminalität“ wird als solche ja kaum wahrgenommen.
Ich habe mich intensiv mit der Darstellung von Migranten in den Massenmedien beschäftigt und mir eine rheinische Boulevardzeitung angeschaut. Auf der Titelseite waren die „Klau-Kids“ vom Dom, also rumänische Kinder, die Passanten bestohlen hatten, ganz groß aufgemacht. Und auf einer Seite ganz hinten ging es um den deutschen Einzeltäter, der durch Betrug einen Schaden in mehrfacher Millionenhöhe angerichtet hatte. Der wurde nicht als besonders kriminell dargestellt. Arme oder Menschen anderer Herkunft und Hautfarbe stehen ganz anders im Fokus. Dadurch fühlen sich deutsche Mittelschichtangehörige eher von den Armen bedroht. Und nicht von denen, die den größten Schaden anrichten. Mit diesen Tätern haben sie auch wenig Berührungspunkte – aber der Mensch neigt dazu, die Erfahrungen aus seinem Nahbereich zu verabsolutieren. Die Klau-Kids kennen sie, sei es vom Dom oder aus der Zeitung. Denjenigen Reichen, der Lohndumping betreibt oder Steuerbetrug begeht, kennen sie nicht.
Haben Sie ein Beispiel aus Ihrem Nahbereich?
In der Straße meiner Mutter lebte eine ältere Frau, die Sozialhilfe bezog, aber früher mit einem reichen Mann liiert gewesen war. Aus jener Zeit besaß sie noch teuren Schmuck und Pelzmäntel, die sie beim Sozialamt nicht als Vermögenswerte angegeben hatte. Besser situierte Frauen aus der Nachbarschaft zerrissen sich darüber den Mund. Es hat sie aber nicht aufgeregt, dass sich der halbseidene Bauunternehmer Dietrich Garski zur selben Zeit 100 Millionen D-Mark vom Berliner Senat für ein Immobilienprojekt in Saudi-Arabien erschlichen hatte. Das war für die Nachbarinnen meiner Mutter viel zu weit weg, während die Sozialhilfeempfängerin im unmittelbaren Nahbereich lebte. Subventionsbetrug, Steuerhinterziehung, Lohndumping oder Schwarzarbeit war ihnen fremd, weil sie als Mittelschichtfrauen dieser Form der Kriminalität nicht ausgesetzt waren oder sogar davon profitierten. Als Mittelschichtsangehörige haben sie allenfalls Kontakt zu Ärmeren – und sei es, dass die für sie putzen.
Sie forschen schon lange zu Armut…
… ja, das hat 1995/96, also vor einem Vierteljahrhundert, angefangen. Damals war ich an der Fachhochschule in Potsdam und bildete Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen aus. Studierende wiesen mich auf die sich in den östlichen Bundesländern ausbreitende Kinderarmut hin und fragten, ob ich ein Projekt oder eine Veranstaltung dazu anbieten könne, und das habe ich dann getan. Daran haben sich Forschungsprojekte und Bücher zur Kinderarmut angeschlossen, weshalb mir bis heute das Etikett des „Armutsforschers“ anhaftet. Das finde ich unpassend, weil ich mich ja auch mit vielen anderen Themen beschäftige und auch mehr und mehr dazu gekommen bin, die Armut immer in den Zusammenhang mit Ungleichheit zu stellen. Wenn überhaupt, würde ich mich als Armuts- und Reichtumsforscher bezeichnen.
Aber Sie haben sich in diesen 25 Jahren eine große Expertise im Bereich Armut erworben.
Ja, besonders im Hinblick auf die gesellschaftlichen Ursachen. Denn Armut wird bei uns häufig nur als individuelles Problem angesehen – dabei handelt es sich um ein strukturelles Problem, das eng mit dem Reichtum zusammenhängt. Wie Bertolt Brecht es so schön ausgedrückt hat: „Armer Mann und reicher Mann standen da und sah’n sich an. Und der arme sagte bleich: Wär’ ich nicht arm, wärst du nicht reich.“ Auch für Verbrechen gilt, dass sie mit Armut und Reichtum zusammenhängen.
Wenn Armut als individuelles Problem gesehen wird, gegen das man mit Leistung etwas tun kann, das also letztlich selbst verschuldet ist – kommen wir da nicht schnell zu einem gesellschaftlichen Bild, das Arme nicht als Opfer, sondern als Täter zeichnet?
Das gilt besonders, wenn Arme, was in unserer Gesellschaft ja der Fall ist, als Drückeberger, Faulenzer und Sozialschmarotzer abgewertet werden. Wenn Sie an Hartz-IV-Bezieher denken, dann haftet denen ja dieser Makel an, dass sie selbst schuld sind und dass sie sich nicht genug angestrengt haben. Bei uns wird die Ungleichheit in der Gesellschaft gerechtfertigt mit dem meritokratischen Mythos, dass wer sich anstrengt und etwas leistet, mit Wohlstand und Reichtum bis ans Lebensende belohnt wird. Und dass wer auf der faulen Haut liegt und vielleicht auch kriminell ist, mit Armut bestraft wird.
Das ist der ideologische Hauptstrang, um Strukturen der Ungleichheit in unserer Gesellschaft zu rechtfertigen und aufrechtzuerhalten. Wenn gesagt wird, dass der, der arm ist, faul ist und sozial schmarotzt, dann ist der Schritt nicht weit, dass diese Person auch als kriminell betrachtet wird, weil sie „uns“ bewusst ausnutzt und auf der Tasche liegt.
Tun Arme das?
Der Sozialleistungsmissbrauch wird in diesem Sinne maßlos überschätzt. Alle Untersuchungen dazu ergeben, dass sich das im Promille- oder höchstens im niedrigen Prozentbereich bewegt.
Wird Armut indirekt kriminalisiert in Deutschland?
Ein Stück weit ist das der Fall. Zunächst wird Armut stigmatisiert. Derjenige, der arm ist, bekennt sich nicht dazu, sondern schämt und versteckt sich meistens. Das ist übrigens für mich ein Kennzeichen von relativer Armut, die in unserer reichen Gesellschaft überwiegt. Absolute Armut wird fälschlicherweise nur in den Ländern des globalen Südens verortet und ist dort nicht stigmatisiert. Wenn Sie in einem Slum in Nairobi aufwachsen, müssen Sie sich für Ihre Armut weder rechtfertigen noch werden sie scheel angesehen. Aber in einer reichen Gesellschaft gilt Armut eben als etwas Anstößiges, das selbst verschuldet und eher kriminell, weil selbst herbeigeführt ist.

Foto: Picture Alliance/ZB/Thomas Eisenhuth
Wo kommt dieses Zerrbild her?
Das hat einerseits sicher mit unserer reichen kapitalistischen Gesellschaft zu tun. Aber auch damit, dass Hartz-IV-Bezieher stärker stigmatisiert und kriminalisiert werden, als das zum Beispiel den Armen in den fünfziger Jahren widerfuhr. Heute gibt es mehr Arme. Außerdem ist der Einfluss des Neoliberalismus größer. Eine Gesellschaft, die stark auf Marktmechanismen hin orientiert ist und erwartet, dass jeder entsprechend der Verwertungslogik funktioniert, stigmatisiert Armut stärker. Der Neoliberalismus hat zur Jahrtausendwende an Einfluss gewonnen; Stichworte sind Gerhard Schröders „Agenda 2010“ und die Hartz-Gesetze. Heute ist das eher noch stärker ausgeprägt.
Und die Ungleichheit steigt?
Ja. Das ist ebenfalls ein Produkt dieser Entwicklung, denn Ungleichheit wird nicht mehr als etwas Negatives gesehen, sondern ganz im Gegenteil als willkommene Triebkraft für individuelle Hochleistungen. Es heißt, die Ungleichheit motiviere die Menschen, sich mehr anzustrengen. Damit hat Ungleichheit ihr negatives Image verloren, obwohl große Ungleichheit dazu führt, dass eine Gesellschaft auseinanderfällt, der soziale Zusammenhalt schwindet und sich Spannungen häufen.
Und zugleich steigt die Armut?
Rein statistisch betrachtet hat sie einen Rekordwert erreicht. Und das bereits vor der Pandemie. Nach dem Mikrozensus galten 13,2 Millionen Menschen oder 15,9 Prozent der Bevölkerung hierzulande 2019 nach EU-Kriterien als armutsgefährdet. Ihnen stehen, wenn sie alleinstehend sind, monatlich weniger als 1.074 Euro zur Verfügung. Das relativiert man teilweise mit dem Argument, dass auch Studierende darunter sind, die später viel mehr verdienen. Dabei geht es immer um Haushalte. Wer im Studentenheim, im Pflegeheim oder in einer Flüchtlingsunterkunft lebt, wird gar nicht mitgezählt. Ebenso wenig erfasst werden die Wohnungslosen, etwa 678.000 an der Zahl, sowie die Obdachlosen, rund 41.000 Menschen.
Erhöht steigende Armut oder steigende Ungleichheit sowohl die Zahl der Verbrechen als auch die Angst vor Verbrechen?
Das ist eine schwierige Frage, weil man hier schauen müsste, auf welche Art von Kriminalität wir uns beziehen. Tendenziell würde ich der These zustimmen, denn Ungleichheit macht die Gesellschaft inhumaner. Drogensucht, Gewaltkriminalität und Brutalität auf den Straßen nehmen in ungleichen Gesellschaften zu. Aber es spielen natürlich auch andere Faktoren eine Rolle, weshalb das nicht monokausal zu sehen ist.

Foto: Frank Schwarz
Am prägnantesten untersucht haben das zwei britische Forscher, Richard Wilkinson und Kate Pickett, in einem Buch, das auf Deutsch „Gleichheit ist Glück“ heißt. Sie haben herausgefunden, dass ungleiche Gesellschaften vollere Gefängnisse haben, mehr Suizide, eine höhere Säuglingssterblichkeit und eine niedrigere Lebenserwartung. Sie haben ziemlich schlüssig nachgewiesen, dass Ungleichheit auf allen Gebieten mehr Probleme schafft. Natürlich auch in der Kriminalität. Wenn Sie mir noch ein Wort zur Ungleichheit gestatten?
Aber bitte.
Als Mitglied im Wissenschaftlichen Gutachtergremium für den Sechsten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung habe ich da sehr genau beobachtet, dass dieser dazu dient, die Ungleichheit zu vernebeln und die Armut zu verharmlosen. Getreu dem Motto: „Guckt mal, in Kalkutta verhungern die Menschen an der Straßenecke. In Köln geht’s Armen doch relativ gut, wenn sie in einem Hochhaus am Rande der Stadt leben. Mit Hartz IV geht’s ihnen besser als in Indien, also gibt’s auch bei uns eigentlich gar keine wirkliche Armut.“ Das so darzustellen, ist auch ein Medientrend. Selten werden Armut und Reichtum an unterschiedlichen Indikatoren gemessen. Ich würde Armut am Einkommen messen, aber Reichtum am Vermögen, das die Armen gar nicht haben.
Im Sechsten Armuts- und Reichtumsbericht wird zum Beispiel als einkommensreich derjenige angesehen, der mehr als das Doppelte des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Das sind knapp 3900 Euro. Die mehr als 150 Milliardäre in unserem Land würden sich totlachen, wenn sie wüssten, dass die Bundesregierung einen Studienrat wegen seines Gehalts für reich erklärt. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung liegen über 67 Prozent des Nettogesamtvermögens des Landes bei zehn Prozent der Bevölkerung. Das reichste Prozent der Bevölkerung besitzt noch mehr als 35 Prozent. Und das reichste Promille unserer Bevölkerung besitzt immer noch 20,4 Prozent des Nettogesamtvermögens. Daran können Sie sehen, dass das Vermögen sich sehr stark konzentriert.
Eine Zahl, die wir in Vorbereitung auf dieses Gespräch gefunden haben, lautet zwei Prozent. Der Anteil von Wirtschaftsdelikten in der Gesamtkriminalität liegt bei zwei Prozent. Der dadurch angerichtete Schaden bei 50 Prozent. Sind wir bei der Kriminalität auf dem reichen Auge blind?
Das kann man so sagen. Menschen, die in diesem Bereich unterwegs sind, haben Zugang zu Medien, haben die Möglichkeit, sich durch hochspezialisierte Anwälte sowohl vor Medienberichten als auch vor Verurteilungen zu schützen. Und sie haben die Möglichkeit, sich ein positives Image aufzubauen und sich entsprechend in der (Medien-)Öffentlichkeit zu präsentieren. Was wieder das Klischee vom armen Kriminellen bestärkt.
Sie sprachen gerade den Schutz durch hochspezialisierte und damit teure Anwälte an, beispielsweise um sich vor Verurteilungen zu schützen. Wenn das so ist: Haben wir eine Klassenjustiz?
Interessant wäre, welche Urteile gefällt würden, wenn Angeklagte ihren Verteidiger per Los zugewiesen bekämen. Das wäre eine Lösung, die vielleicht mehr Gerechtigkeit brächte, mit unserem marktwirtschaftlichen System aber brechen würde. Diesem ist immanent, dass der, der mehr Geld hat, besser behandelt wird. Sei es im Krankenhaus oder sei es vor Gericht.
Wäre so eine Verlosung von Anwälten nicht fairer?
Auf jeden Fall. Aber wir hätten immer noch das Problem, dass jeder Angeklagte vor Gericht ein Bild seiner sozialen Klasse abgibt. Und ein wohlhabender Angeklagter im Anzug wird anders behandelt als ein ungebildeter Täter aus der Unterschicht. Dessen Risiko, hart angefasst und verurteilt zu werden, bleibt größer. Ungleichheit spielt sich nicht bloß im Vermögens-, sondern auch im Bildungs-, Wohn- und Gesundheitsbereich ab, ja sie durchdringt alle Poren der Gesellschaft – auch Polizei und Justiz bleiben davon nicht unberührt.
Also haben wir als Gesellschaft ein falsches Bild von Kriminalität?
Wir haben ein Zerrbild von Kriminalität. Wie von Armut und Reichtum ja auch. Hierzulande glaubt man, wir hätten kaum Armut und auch keinen extremen Reichtum, seien vielmehr eine „nivellierte“ Mittelstandsgesellschaft. So hat der Soziologe Helmut Schelsky die Bundesrepublik 1953 genannt und damit bis heute ihr falsches Bild von sich selbst geprägt. Wenn Sie die Menschen fragen, wo die Ungleichheit besonders stark ausgeprägt ist, werden die USA, Brasilien und Kolumbien, vielleicht auch Großbritannien oder Südafrika genannt. Das ist zwar nicht falsch. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Deutschland nach dem Gini-Koeffizienten, einem Ungleichheitsmaß, das 0 ist, wenn alle gleich viel besitzen, und 1, wenn einem alles gehört, beim Vermögen mit 0,83 direkt hinter den USA mit 0,85 bis 0,87 liegt.
Wir haben in den Köpfen also ein völlig falsches Bild, was die Ungleichheit angeht. Und auch ein falsches öffentliches Bild der Kriminalität, das von Massenmedien erzeugt wird. Die bereits genannten „Klau-Kids“ verkaufen sich medial offenbar besser als Weiße-Kragen-Kriminalität. Schauen Sie sich nur an, wie wenig über den Cum-Ex-Skandal berichtet wird, wo sich ein kriminelles Netzwerk von Kapitalanlegern, Bankern und hochspezialisierten Steueranwälten allein am deutschen Fiskus um 30 Milliarden Euro bereichert hat.
Dass über die Weiße-Kragen-Kriminalität nicht berichtet wird, stimmt doch nicht. In der „Zeit“, im „Spiegel“ oder der „Süddeutschen Zeitung“ gab es große Recherchen zum Cum-Ex-Skandal.
Sie dürfen nicht den „Spiegel“ oder die „Süddeutsche“ zum Maßstab machen, sondern sie müssen die vielen Regionalzeitungen und den Boulevard nehmen, die viel mehr gelesen werden und das Alltagsbewusstsein prägen. In denen wird über den örtlichen Kegelclub berichtet und vielleicht noch über den arabischen Clan, aber doch nicht über Cum-Ex oder Cum-Cum. Das sind Begriffe, die eigentlich nur Leute kennen, die mit Aktien umgehen. Das ist eine kleine Minderheit und eher besser ausgebildet und materiell bessergestellt.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Armut und Kriminalität?
Ich würde sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Kriminalität. Raub, Einbruch oder Diebstahl wären ja ausgeschlossen, wenn alle extrem arm wären. Doch das eigentliche Problem ist die Ungleichheit, sie scheint mir eine starke Triebkraft für Kriminalität zu sein. Sowohl bei Ärmeren als auch bei Reichen. Wenn ein Jugendlicher bei anderen Jugendlichen ein tolles Handy sieht, das er auch gerne hätte, sich wegen der Armut seiner Familie aber nicht leisten kann, beschafft er sich vielleicht Geld auf kriminellem Wege. Aber auch ein Multimillionär will vielleicht noch reicher werden, weil er nicht als Dollar-Milliardär auf der Forbes-Liste auftaucht. Warum stellt ein Fleischbaron mit einem Milliardenvermögen osteuropäische Werkvertragsarbeiter in seinem Schlachtkonzern ein, die den Mindestlohn nicht bekommen? Das ist doch nur damit erklärbar, dass er noch reicher werden möchte.
Also wäre für Sie der beste Kampf gegen Kriminalität der Kampf gegen Ungleichheit?
Ja, absolut. „Die beste Kriminalpolitik liegt in einer guten Sozialpolitik“, meinte der Marburger Strafrechtslehrer Franz von Liszt im 19. Jahrhundert. Damit meinte er die Kriminalprävention. Wer die Armut bekämpft und die Ungleichheit, tut auch etwas gegen die Kriminalität. Ich wünsche mir von der nächsten Bundesregierung, dass sie auf der einen Seite mit guter Sozialpolitik die Armut bekämpft und auf der anderen Seite mit Steuerpolitik dafür sorgt, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich nicht weiter vertieft, sondern wieder ein Stück weit schließt.
Tobias Großekemper und Karsten Krogmann
- Zurück im Leben
- Noch mehr Attacken auf die Demokratie
- Ausnahmezustand für Opfer … und für Helfer
- WEISSER RING hilft Opfern nach mutmaßlichem Anschlag in München
- Wie stehen die Parteien zum Opferschutz?