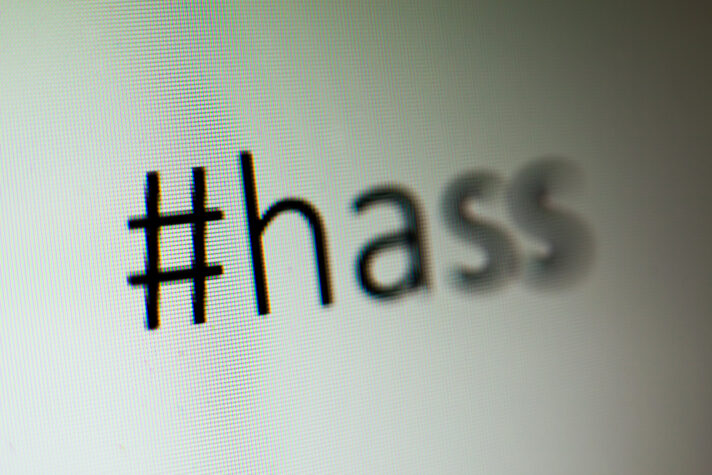Der Schutzpolizei kommt bei Partnerschaftsgewalt eine Schlüsselrolle zu: Wenn ein Notruf eingeht, sind ihre Streifen die Ersten am Tatort, sie bewerten die Situation, müssen Opfer- und Täterschaft einschätzen und entscheiden, ob jemand die Wohnung verlassen muss. Wie sensibilisiert ist die Polizei für Beziehungsgewalt gegen Männer? Und wie oft wird diese in den Bundesländern registriert? Ausgehend von den Erkenntnissen aus einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) zu Partnerschaftsgewalt gegen Männer, für die Betroffene mit einem Onlinefragebogen und in Interviews befragt wurden, hat sich die Redaktion mit einem Fragenkatalog an die zuständigen Landesinnenministerien und das Bundeskriminalamt (BKA) gewandt. Eine Auswertung und Einordnung zur Rolle der Polizei.
Die KFN-Studie fragt gewaltbetroffene Männer nach Erfahrungen mit Beratungsstellen und Polizei: Wurden diese Hilfsangebote in Anspruch genommen? Falls nein, warum nicht? Und falls ja, wie fällt die Bewertung der Erfahrung aus? Von den 1.209 Teilnehmern der Onlinebefragung hatten nur rund 8 Prozent Kontakt zu Polizei und / oder einer Beratungsstelle. Kontakt zur Polizei war besonders selten: Gerade einmal 11 Männer berichteten davon. Im Vergleich zu den Erfahrungen mit den Beratungsstellen fielen die auf die Polizei bezogenen Bewertungen deutlich negativer aus. Von den 16 Interview-Teilnehmern hatten ebenfalls 11 Polizeikontakt. Dieser wurde sehr gemischt wahrgenommen: Es gab Schilderungen von positiven und negativen Eindrücken.
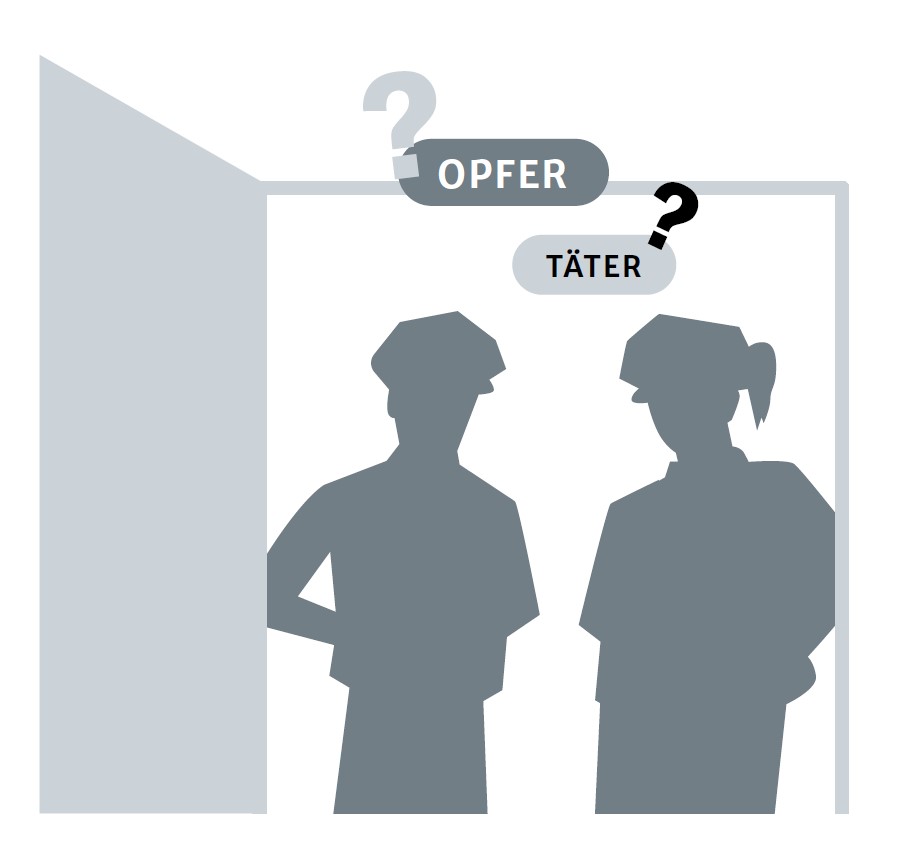
In den Rückmeldungen der Landespolizeien auf die Anfrage der Redaktion wird klar: Sämtliche Behörden bemühen sich, Wissen über Opferbedürfnisse und -perspektiven in Ausbildung und Studium unterzubringen, zudem gibt es oft freiwillige und offenbar gut besuchte Fortbildungsangebote. Häufig fällt der Hinweis, dass es sich um interdisziplinäres oder ganzheitliches Lernen handele, Inhalte zum Thema würden in unterschiedlichen Fächern mit unterrichtet, etwa in „Psychologie“ oder „Einsatztraining“. In den Lehrplänen ist häusliche Gewalt demnach ein fester und präsenter Bestandteil. Genau hier tut sich jedoch ein Problem auf: „Der Begriff ‚häusliche Gewalt‘ unterliegt keiner einheitlichen Definition“, schreibt das baden-württembergische Ministerium. Zwar erläutert das BKA im Bundeslagebild 2022, dass häusliche Gewalt „alle Formen körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt“ umfasst und sich zusammensetzt aus „familiärer sowie partnerschaftlicher Gewalt“. Das bedeutet: Es wird unterschieden zwischen Kriminalität innerhalb einer Familie, von der zum Beispiel Kinder oder Großeltern betroffen sind, und Partnerschaftsgewalt, bei der Opfer und Täter beziehungsweise Täterin in Ehen, eingetragenen Lebenspartnerschaften oder nicht ehelichen Lebensgemeinschaften leben oder gelebt haben.
In den Ländern scheint es jedoch unterschiedliche Auffassungen darüber zu geben, was unter häusliche Gewalt fällt. Obwohl sich die Anfrage explizit auf Partnerschaftsgewalt bezieht, schreiben die Länder in ihren Antworten oft von häuslicher Gewalt, die Ausführungen bleiben so zum Teil sehr allgemein.
➡ Lesen Sie hier alle Antworten aus den Ländern (PDF-Datei)
Was die Ministerien einigermaßen deutlich vermitteln: Männliche Opfer sind mitgemeint. Der „Aspekt ‚Gewalt gegen Männer‘“ werde auch aufgegriffen, heißt es etwa aus Baden-Württemberg und in Sachsen-Anhalt. In Schleswig-Holstein wird „vorrangig die Perspektive der am häufigsten betroffen Personengruppe von häuslicher Gewalt (Frauen) betrachtet“, es werde aber auch auf die Belange von männlichen Betroffenen eingegangen, die Behörde unterstreicht: „Die Thematik Partnerschaftsgewalt wird insofern nicht nur einseitig geschlechtsspezifisch unterrichtet.“ Gewalt gegen Männer werde „mitbehandelt, beispielsweise in Bezug auf Besonderheiten, einschlägige Statistiken, aktuelle Forschung etc.“, schreibt schließlich das Innenministerium in Sachsen-Anhalt.
Selbsteinschätzung „sensibel, empathisch und opferschützend“
Den KFN-Wissenschaftlern berichteten die interviewten Männer, dass sie sich teilweise aufgrund ihres Geschlechts nicht getraut hätten, die Polizei zu rufen, „weil sie befürchteten, als Mann als Täter vorverurteilt zu werden und nicht ernst genommen zu werden“, heißt es im Forschungsbericht. Ein Betroffener erinnerte sich beispielsweise an die Situation, wie er den Notruf wählte und von einem Polizisten gefragt wurde, ob der Einsatz wirklich notwendig sei. Erst nach wiederholtem Bitten sei eine Streife geschickt worden – unter Androhung negativer Konsequenzen, falls sich der Einsatz nachträglich als nicht nötig herausstellen sollte.
Auf die Fragen nach geschlechtsspezifischer Opfersensibilisierung für den Kontakt mit Betroffenen von Partnerschaftsgewalt antworten die angeschriebenen Behörden unterschiedlich. Eine solche Sensibilisierung gibt es in Bremen „seit Jahrzehnten“. Rheinland-Pfalz und Berlin geben an, Kommunikation mit Opfern werde eher „geschlechtsneutral“ vermittelt. Keine spezielle Sensibilisierung für den Kontakt mit männlichen Opfern gibt es in Berlin, Bayern, Sachsen, im Saarland und in Hessen, das noch auf das humanistische Menschenbild hinweist, welches im Studium vermittelt werde.
Die Selbsteinschätzung in Niedersachsen lautet: „Im Rahmen von Einsätzen und Ermittlungsverfahren der Polizei erfolgt der Umgang mit Betroffenen von Straftaten sensibel, empathisch und opferschützend.“ Ähnlich pauschal fallen die Aussagen anderer Länder aus, immer wieder wird einem sensiblen Opferkontakt ein „hoher Stellenwert“ eingeräumt, immer wieder wird besonders die Professionalität und Neutralität der Beamten und Beamtinnen hervorgehoben. Weitergehende Belege dafür gibt es nicht.
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Saarland und Thüringen: Diese Länder haben nach eigenen Angaben spezielle Dienststellen, Kriminalkommissariate, Beziehungsgewalt- oder Schwerpunktsachbearbeitende, die zentral Fälle häuslicher Gewalt oder Partnerschaftsgewalt bearbeiten. In Baden-Württemberg werden dort „geschlechtsbezogene Bedürfnisse von Opfern individuell berücksichtigt“. Allerdings sind dies nachgelagerte Stellen und nicht diejenigen Personen, die am Tatort den ersten Kontakt mit Betroffenen haben. In Thüringen gibt es keine speziell ausgebildeten Ansprechpartner: „Stattdessen ist die Thüringer Polizei darauf bedacht, Geschlechterstereotype nicht noch zu verstärken, sondern alle Beamtinnen und Beamten gleichermaßen zu befähigen, die besonderen Bedarfe männlicher, weiblicher und divers geschlechtlicher Geschädigter im Kontakt zu diesen zu berücksichtigen.“
Nicht zum Vergleich geeignet
Das Definitionsproblem von häuslicher Gewalt zeigt sich auch in der unterschiedlichen Datenerfassung. Die meisten Länder orientieren sich bei der Zusammenstellung der Zahlen an der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), diese ist laut Rheinland-Pfalz bundesweit gültig und unterliegt einheitlichen Erfassungs- und Qualitätskriterien. Sachsen macht dies aber beispielsweise erst seit 2022. Und in Bayern nimmt das Landeskriminalamt eine „Sonderauswertung häusliche Gewalt“ vor, für die Daten aus dem „polizeilichen Vorgangsverwaltungssystem“ recherchiert werden. Die Behörde in Thüringen ordnet ein: „Die Zahlen sind nicht mit Daten aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (Ausgangsstatistik) oder Daten anderer Bundesländer vergleichbar.“

Auch die Zählweise erschwert den Vergleich: Zum Teil werden die Fälle gelistet, das bedeutet, wenn eine Person mehrfach Opfer wird, kommen mehrere Fälle zustande. Demgegenüber werden andernorts nur die betroffenen Personen registriert, nicht aber die Anzahl der Fälle, in denen jemand Opfer geworden ist. Belastbare Aussagen über die Situation der männlichen Opfer von Beziehungsgewalt in den Bundesländern bleiben damit ausgeschlossen.
Isoliert zu betrachten sind daher einige Hinweise in den Auskünften: Mehrere Länder verzeichneten in der jüngeren Vergangenheit einen Anstieg der Partnerschaftsgewalt, es wird vermutet, dass es mehr Anzeigen von männlichen Opfern gab. In Hamburg beispielsweise stieg der Anteil männlicher Betroffener von 17,4 Prozent im Jahr 2013 auf 22,4 Prozent im Jahr 2023. Eine im Jahr 2022 in Bremen durchgeführte Sicherheitsbefragung habe gezeigt, so die dortige Behörde, dass von den Befragten nur etwa jede fünfte Körperverletzung und nur knapp jede zehnte Bedrohung durch einen (Ex-)-Partner oder eine (Ex-)Partnerin angezeigt wurde. BKA-eigene Dunkelfeldstudien erlauben laut der Bundesbehörde bislang keine Aussage zum Anzeigeverhalten von Männern. Thüringen teilt mit: „Die Gründe für eine niedrige Anzeigebereitschaft sind vielfältig, sehr individuell und liegen nicht zwingend im Wirkungsbereich polizeilichen Handelns.“
Aufgabe für Polizei und / oderGesellschaft?
Die in der KFN-Studie interviewten Männer beschrieben mitunter eine problematische Situation: Partnerinnen beschuldigten die gewaltbetroffenen Männer als Täter, die Einsatzkräfte glaubten eher den Frauen – insbesondere, wenn Kinder involviert waren – und die Männer mussten die Polizei erst einmal davon überzeugen, dass sie die tatsächlichen Opfer waren. Insgesamt bemängelten die Befragten eine fehlende emotionale Kompetenz, vor allem wenn keine äußerlich sichtbaren Verletzungen vorlagen. Den Erzählungen zufolge gab es Fälle, in denen das Opfer – nicht die Täterin – der Wohnung verwiesen wurde.
Existiert in der Polizistenkultur ein Stereotyp des „starken Geschlechts“ vom Mann, der kein Opfer sein kann? Die mehrheitlich übereinstimmende Antwort, die die Redaktion von den angefragten Behörden erhielt: Zu den Einstellungen von Polizeikräften – und ob diese „das polizeiliche Handeln qualitätsmindernd“ beeinflussen, wie es aus Thüringen heißt – gebe es keine wissenschaftlichen Untersuchungen.
➡ Christiane Feichtmeier (GdP): „Wir als Polizei müssten mehr sensibilisiert werden“
„Dass Männer auch zu Opfern und Frauen zu Täterinnen werden können, wird gegenwärtig immer noch gesellschaftlich tabuisiert. Dieser Umstand wie auch das tradierte Rollenverständnis erschweren es männlichen Opfern häufig, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen“, schreibt das Bremer Ministerium. Die Berliner Behörde reflektiert: „Dieser Aspekt spiegelt sich folglich auch im polizeilichen Einsatzgeschehen wider, sodass bei männlichen Betroffenen möglicherweise der (…) Eindruck einstehen könnte, dass Männer zunächst eher als Täter eingeordnet werden.“ In Sachsen-Anhalt gibt man sich dagegen überzeugt, dass „keine geschlechtsbezogenen Unterschiede bei einem Opferkontakt gemacht“ werden. Als einziges Bundesland kehrt Bremen hervor: „Sollte Voreingenommenheit innerhalb der Polizei festgestellt werden, gilt es diese grundsätzlich aufzuklären und zu bekämpfen.“
Ein zum Redaktionsschluss noch laufendes Forschungsprojekt in Mecklenburg-Vorpommern trägt den Titel „Opfer von häuslicher Gewalt im Kontakt mit Polizeivollzugskräften in MV“ und betrachtet laut dem Innenministerium auch das Merkmal Geschlecht. Den Angaben auf der Projektwebseite nach sollen Betroffene nach ihren Erwartungen an die Polizei befragt werden und die Ergebnisse im März 2024 vorliegen.
Unter den acht Handlungsempfehlungen, die die KFN-Forscher am Ende ihres Berichts formuliert haben, befinden sich zwei mit Polizeibezug. So sollten Polizeikräfte „für unterschiedliche Täter-Opfer-Konstellationen bei häuslicher Gewalt noch stärker sensibilisiert werden“. Zudem gibt es den Vorschlag einer „Sensibilisierungskampagne“ für Partnerschaftsgewalt, die auch die Betroffenheit von Männern thematisiert und die Rolle sowie Aufgaben von Akteuren wie der Polizei erklärt.
Nina Lenhardt
Alle Texte der Recherche im Überblick:
➡ #WRstory: Wenn Männer Opfer von Partnerschaftsgewalt werden
➡ Ruhe im Karton: Wie in Oldenburg Deutschlands erste Männerschutzwohnung entstand
➡ Nachgefragt: Warum viele Bundesländer keine Zufluchtsorte für Männer anbieten
➡ Ministerin Lisa Paus: „Ich führe das Gesellschaftsministerium – und das ist auch für Männer da“
➡ BFKM-Chef Frank Scheinert: „Es ist unser Job, immer wieder die Hand zu heben“
➡ Nachgefragt: Wie die Polizei auf Beziehungsgewalt gegen Männer blickt
➡ Christiane Feichtmeier (GdP): „Wir als Polizei müssten mehr sensibilisiert werden“
➡ Traditionelle Männerbilder: Die Schwäche der Superhelden
➡ KFN-Studie: Fakten und Zahlen zur Untersuchung von Partnerschaftsgewalt gegen Männer
➡ KFN-Studienleiter Schemmel: „Das fehlende Selbstverständnis als Opfer spielt eine zentrale Rolle“