Als Betrüger wäre Gerd Mainzer eine große Nummer. Nach wenigen Minuten würde man ihm Passwörter, Autoschlüssel und die eigenen Kinder anvertrauen. Ein 66-Jähriger mit gepflegten grauen Haaren, der nüchtern und interessiert zugleich durch seine Brille, Typ Kassengestell, blickt. Zum Glück ist Gerd Mainzer kein Betrüger. Was er allerdings an diesem Tag gerade ist, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Pensionierter Leiter einer Polizeiwache? Außenstellenleiter des WEISSEN RINGS? Stadtbeauftragter der Malteser Bonn? Gerd? Jedenfalls auch einer, der sich freut, dass der Apfelschnitz so „schön sauer“ schmeckt.
Fest steht schon mal, wo er an diesem Vormittag ist: Walporzheim, Rheinland-Pfalz. Ein Dorf mit nicht mal 700 Einwohnern, das zu Bad Neuenahr-Ahrweiler gehört. Es ist einer der guten Herbsttage, der Himmel ist blau, auf der einen Seite die Weinberge, auf der anderen die bewaldeten Hügel. Mainzer steht zwischen einem großen weißen Zelt und der Dorfkirche und plaudert mit einigen Bewohnern. Er ist angezogen wie für einen Katastropheneinsatz: Jacke mit viel Orange und reflektierenden Streifen, Cargo-Hose, schwere Schuhe, die Arbeitskleidung der Malteser. Nur der Rucksack verleiht ihm etwas Jugendliches. Ein Modell, das man auf eine leichte Wanderung mitnehmen würde. Er möchte aber bloß seine Runde durch den Ort machen. Noch ist er nicht aufgebrochen, da sagt schon einer über ihn: „Er war einer der Ersten mit Uniform hier.“
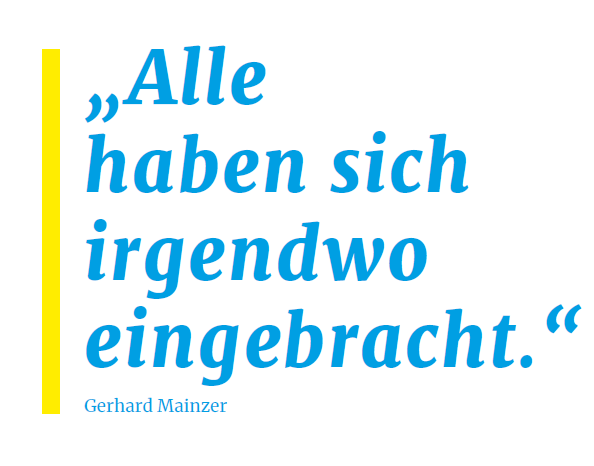
Lang her ist die Katastrophe noch nicht. Am 14. Juli erhält Mainzer gegen 22 Uhr einen Anruf seiner Schwester aus Walporzheim. Sie wohnt im Elternhaus, er knapp 50 Kilometer entfernt in Königswinter bei Bonn. Das Wasser stehe im Erdgeschoss, sagt die Schwester, der Hund wolle nicht hochkommen in die erste Etage und das Handy sei auch bald leer. Der Strom sei ausgefallen. Nachts schickt sie eine SMS. Vor dem Haus hänge eine Frau im Baum. Dann erreicht Mainzer seine Schwester nicht mehr. Hinfahren ist unmöglich. Wie denn auch? In den Nachrichten ist zu erfahren, dass keine Region so stark vom Regen betroffen ist wie der Landkreis Ahrweiler. 134 Menschen sterben durch das Hochwasser, eine tote Frau wird erst in Rotterdam aus dem Wasser gezogen. Wie hoch die Ahr am Ende stand, weiß niemand, weil die Messgeräte dafür nicht ausgelegt waren. Schätzungen gehen von mehr als sieben Metern aus, doppelt so viel wie der bisherige Höchststand von 2016. 17.000 Häuser sollen verlorengegangen sein oder erhebliche Schäden erlitten haben. Nach ein paar Tagen schafft es Mainzer mit dem Auto bis in seinen Heimatort, die Schwester lebt, aber überall ist Chaos. Es gibt Fotos von Walporzheim nach der Flut, die aussehen, als habe jemand am Computer einen Müllberg in die Straße hineinkopiert – allerdings einen Müllberg, in dem Autos stecken. Für Mainzer steht fest: Er muss helfen. Im Auftrag der Malteser baut er als Ehrenamtler die nächsten Wochen eine medizinische Versorgung auf. Die erste Zeit fährt er fast täglich ins Dorf, 760 Arbeitsstunden in drei Monaten, schätzt er. Gegenüber dem großen weißen Zelt, in dem Helfer und Bewohner kostenlos essen können, steht nun ein Container, der mit einem Sanitäter besetzt ist.

Wer mit Mainzer durchs Dorf geht, stellt schnell fest, dass die Flut zwar durch ist, das Thema Flut aber noch lange nicht, auch wenn sich die Öffentlichkeit mehr als drei Monate danach wieder anderen Themen zugewandt hat. So vieles ist noch immer nicht wie vorher. Züge fahren erst mal keine. Es gibt Häuser, die bereits von außen völlig zerstört aussehen, es gibt Lücken, in denen mal Häuser standen, Fassaden sind mit Schlamm bespritzt. Man wird in Walporzheim kein Erdgeschoss finden, das nicht betroffen ist. Die meisten stehen noch leer. Alle Weinlokale sind geschlossen.
Obwohl Mainzer die Flut nicht selbst gesehen hat, weist er beim Rundgang regelmäßig daraufhin, wie hoch das Wasser in diesem und jenem Haus gestanden hat – ein Zeichen dafür, wie sehr sich die vergangenen Monate bei ihm eingeprägt haben. Er läuft vorbei an einer provisorischen Tür, auf der steht „We Ahr Together“, unterschrieben von sehr vielen Menschen. Auch sein Name steht da irgendwo mit drauf. Er betritt das Gemeindehaus, das früher mal eine Grundschule war, seine Grundschule. Hier werden Sachspenden gesammelt und ausgegeben. Von Dosensuppe bis zu alten Schuhen gibt es hier alles. Kinderkleidung haben sie viel zu viel. Gebraucht werden gerade besonders Taschenlampen, Kaffeepulver und Spülmittel. Eine Frau fragt Mainzer nach Trocknern. Er kümmert sich, verspricht er. Ein paar Minuten später erreicht er den Platz, an dem gerade das winterfeste Versorgungszelt aufgebaut wird. Bald bekommt er hier sein eigenes Büro, einen Container, momentan organisiert er seine Projekte noch „vom Rucksack“ aus, wie er sagt. Der Container sollte längst da sein. Er ärgert sich.
Vor einem Haus fragt er ein altes Paar, ob sie ihr Geld schon bekommen haben. Ja, haben sie. „Es wird“, sagt die Frau zum Abschied. Das Geld, das ist die Soforthilfe von 2.500 Euro, die jedem vom Hochwasser betroffenen Haushalt auf Antrag bei diversen Hilfsorganisationen zusteht. Mainzer hat auch die besucht, die es nicht zur Info-Veranstaltung geschafft hatten. Da hilft es, wenn man die Leute kennt. Wenn er auf Bekannte trifft, verändert sich seine Sprache. Mit Fremden spricht er eher formell. Fragt man Mainzer nach den Toten und ob sie ertrunken oder von Bäumen oder Autos erschlagen wurden, sagt er: „Tot waren sie halt.“ Was soll die blöde Frage?, heißt das. Das ändert sich, wenn er mit den Leuten aus dem Dorf spricht. Dann wird er lockerer, weicher. „Na, wie isset?“ In Walporzheim ist er immer auch Walporzheimer.
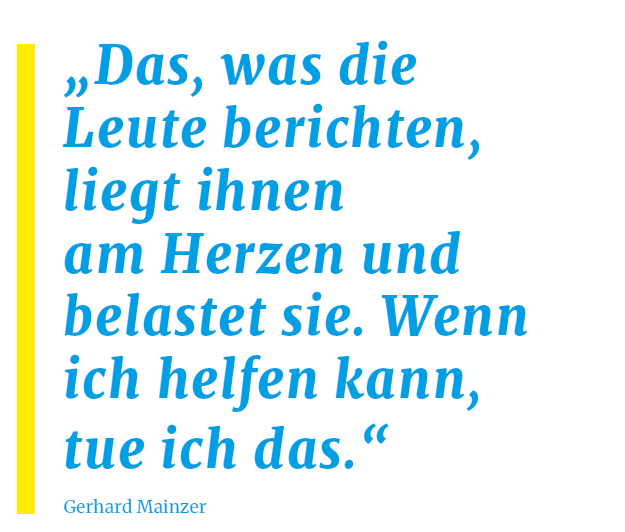
Er erreicht nun die Ahr, das Ufer ist aufgerissen. Hier steht nicht nur ein großes Zelt, in dem ein für die Bewohner kostenloser Baumarkt untergebracht ist, sondern auch ein Containerdorf für Helfer. Verantwortlich dafür ist ein Gartenbauunternehmer aus Hessen. Und genau dem läuft Mainzer jetzt über den Weg. Mit einem weiteren Mann geht dieser gerade durch den Ort und verteilt Geld und Gutscheine, die sie in einem Korb tragen. Ob er noch Leute kenne, die Bedarf hätten? Mainzer will darüber nachdenken. Er lässt sich nicht anmerken, dass ihm der Mann nicht ganz geheuer ist. Er findet es eher ungeschickt, die Zuwendungen zu verteilen wie der Weihnachtsmann. Mainzer will da nicht falsch verstanden werden, die Helfer von außen waren wichtig für den Ort. Überall hängen Dankesplakate an Zäunen und Fenstern. Doch er findet, so allmählich müsse das Dorf wieder mehr für sich selbst sorgen. Der Gartenbauunternehmer ist ein ganz anderer Helfer-Typ als Mainzer. Herr Hartmann trägt einen Kapuzenpullover mit dem Aufdruck „Mach es wie die Hartmanns – sei ein HARTmann!“ Man hat ihm auch eine lebensgroße Holzfigur geschnitzt und eine provisorische Straße im Containerdorf nach ihm benannt. Mainzer, der ohnehin eher aussieht wie in Stein gehauen, hätte den Leuten vermutlich einen Vogel gezeigt. Später wird ein Schreiner Mainzer erzählen, bei ihm hätten die Helfer schon Unkraut pflücken wollen. Bei einem anderen hätten sie die Kieselsteine gereinigt.
Auch Mainzer erzählt gern von dem, was er leistet. Später auf der Rückfahrt hört man die Geschichten aus seiner Zeit als Polizist, Erster Hauptkommissar war er, mehr geht nicht im gehobenen Dienst. Wie er über den Zugriff bei einer Kindesentführung entscheiden musste. Wie er einen Kaiserschnitt anordnete, um Leben zu retten. Wie er einer Frau 50 Mark lieh, die gerade Pfandgeld gestohlen hatte, aber Essen für ihre Kinder brauchte. Der Kollege sagte, das Geld sehe er nie wieder. Er sah es wieder. Solche Dinge erzählt er aber eher weniger, um damit anzugeben, sondern um einen Punkt zu machen: Dass er schwierige Entscheidungen treffen kann. Dass er Vertrauen in Menschen hat.

Wenn Mainzer durch sein Heimatdorf geht, trägt er zwar die Uniform der Malteser, aber er ist auch immer Außenstellenleiter des WEISSEN RINGS Ahrweiler. Das Telefon hat er immer dabei. „Das ist ja ein Mobiltelefon“, sagt er trocken. 2018 übernahm er den Posten, ein Jahr nach seiner Pensionierung. Wie leitet man nun eine Beratungsstelle für Kriminalitätsopfer, wenn plötzlich ganz andere Opfer im Vordergrund stehen, die Betroffenen der Flut? Am Tag zuvor hat er eine Videokonferenz mit seinen Leuten gemacht, um zu schauen, wie die Lage bei ihnen ist. Nach dem Hochwasser dauerte es eine Weile, bis er alle 15 überhaupt erreicht hatte. Betroffen waren sie alle irgendwie. Am schlimmsten der Mitarbeiter, der sein Haus verlor. Wen es selbst nicht so stark erwischt hatte, kümmerte sich um Familienangehörige, half im eigenen Ort mit. „Alle haben sich irgendwo eingebracht“, sagt Mainzer. Zum Beispiel jene Mitarbeiter, die das Glück haben, auf einem Berg zu wohnen. Sie kochen nun für alle, die dazu gerade nicht in der Lage sind. Die Hilfe vor Ort hatte Vorrang vor der Arbeit für den WEISSEN RING. Mainzer versteht das. Wer sich ehrenamtlich engagiert, neigt dazu, sich auch dann zu kümmern, wenn es an anderer Stelle Probleme gibt.
Auch mehr als drei Monate später stehen Mainzer nur zwei bis drei Helfer wieder so zur Verfügung wie vor dem Hochwasser. Die Anrufe hatte ohnehin immer er entgegengenommen, dann die Fälle aber häufig weiterverteilt. Im Juli wurde klar, dass er sich bis auf weiteres allein um die Fälle kümmern musste. „Ich war ja eh hier.“ Auch wenn er mal nicht ans Telefon gehen kann, zurückgerufen hat er immer innerhalb von 24 Stunden, sagt er. Auch wenn die Not, die er selbst vor Augen hatte in Walporzheim, häufig größer war. Man müsse es halt bearbeiten – auch dann, wenn es „nur“ um Betrug geht. „Schlimmer geht immer. Aber das, was die Leute berichten, liegt ihnen am Herzen und belastet sie. Wenn ich helfen kann, tue ich das. Es gibt aber Fälle, die so lebensfremd sind, die lehne ich ab.“ In den vergangenen Monaten hat es aber auch schwere Fälle gegeben, ein Tötungsdelikt, 16 Messerstiche, das Opfer überlebte schwerverletzt. Eine Flut-Helferin wurde vergewaltigt.
Einige Straftaten wurden durch die Flut begünstigt. Einmal warnten Betrüger vor dem nächsten Hochwasser, damit die Leute die Häuser verließen und sie in Ruhe die Wertgegenstände rausräumen konnten. Es gibt auch Betrüger, die den Anschein erwecken, sie würden kostenlos bei Reparaturen helfen, und dann erhöhte Rechnungen ausstellen. Das Hochwasser bringt bei manchen auch verdrängte Traumata wieder hoch. Da kann es sein, dass Mainzer jemanden in seiner Funktion als Malteser besucht, und dann geht’s plötzlich nicht nur um die Soforthilfe. „Da brach alles über die Frau herein, und sie sagte: ‚Jetzt weiß ich gar nichts mehr.‘ Dann schalte ich auf WEISSER-RING-Modus um und dann ist das so.“

Mainzer hat Erfahrungen mit Katastrophen, „aber nicht mit so einer Katastrophe. Solche großen Katastrophen kennt niemand.“ Dennoch sagt er: „Ich bin nicht erstaunt, dass ich das geschafft habe. Ich traue mir das schon zu. Meine Aufgabe ist es zu organisieren.“ Situationen nicht zu sehr an sich heranzulassen, das gehört zu den wichtigsten Fähigkeiten eines Helfers – aber wie will man das machen, wenn die Heimat, wenn Freunde und Familie betroffen sind? Das war auch für Mainzer eine besondere Belastung. Er hat geweint, aber nicht hier vor Ort als Helfer, dafür ist er zu professionell. Seine Frau hat ihn schon mal gebeten, jetzt nicht wieder nach Walporzheim zu fahren. Nicht weil sie den Einsatz in Zweifel zieht, sondern bloß, weil es ihr zu viel erschien. Dann blieb er zu Hause.
Was er jetzt im Ort macht, dafür nutzt er zwar nicht die Mittel des WEISSEN RINGS, sondern der Malteser, aber es ist ganz im Sinne des WEISSEN RINGS: Prävention. Die Leute haben Schlimmes erlebt und überlebt. Das hinterlässt Spuren. Deshalb hat jetzt Bolle seinen Auftritt. Labrador Bolle ist ein sogenannter BBD-Hund, BBD steht für Besuchs- und Begleitdienst. Mainzers Idee ist, dass man in Anwesenheit eines Hundes leichter mit Menschen ins Gespräch kommt, die schwerer zu erreichen sind: alte Menschen, Kinder zum Beispiel. Zusammen mit Besitzerin Birgit Buchloh besuchen sie am Freitagnachmittag das Altenheim. Im Erdgeschoss wird noch renoviert, in der ersten Etage sitzt eine Frau auf dem Balkon und raucht. Wer sich fragt, was ein Hund denn ausrichten könne, sollte sich das unbedingt einmal anschauen. Der eben noch sehr stürmische Bolle wird ruhig. Nach wenigen Minuten überlässt Buchloh der Rentnerin die Leine, der Hund legt sich hin. Sie drückt der Frau noch ein paar Leckerli in die Hand. Ein zweiter Bewohner setzt sich dazu, nimmt auch mal den Hund, dasselbe Spiel. Viel geredet wird nicht, Mainzers Fragen werden mit höchstens einem Satz beantwortet. Aber da ist plötzlich so eine Art Frieden in einem Ort, der noch lange nicht zur Ruhe kommt. Für den nächsten Besuch vereinbaren sie einen Spaziergang mit Hund.
Mainzer macht sich Sorgen, weil jetzt der Winter kommt. Ausgerechnet in der Zeit, in der es kälter und dunkler ist, müssen die Überlebenden mit den psychischen Folgen umgehen. Viele haben noch keine neue Heizung, können das Erdgeschoss nicht nutzen, kämpfen um ihre Existenz. Manche sitzen allein zu Hause. Die Leute hätten sich schon gegenseitig geholfen, sagt Mainzer, aber er beobachte, dass nun auch die Konflikte losgehen. Warum hat mein Nachbar mehr als ich, woher hat er den Trockner? Belastungen, die zur Gefahr werden können. Häusliche Gewalt und Kindesmissbrauch hätten während der Pandemie zugenommen in der Region, sagt Mainzer. Was nach der Flut passiert ist, da fehlen ihm noch die Zahlen. Deshalb sind Projekte wie der Begleithund gut. Er, der vor seiner Zeit als Polizist Kindergärtner war, ist auch mit Kindern in die Reithalle gegangen. Treffpunkte wie die Kirche will er wieder beleben. Die Leute sollen nicht gezwungen sein, zu Hause zu hocken. Dafür nutzt er auch die Kontakte des WEISSEN RINGS. Wenn er zum Beispiel beim Jugendamt anruft, sagt er: Sie kennen mich vom WEISSEN RING, aber heute rufe ich als Malteser an.
Am späten Nachmittag kehrt Mainzer zurück auf den Zeltplatz. Schon ist wieder sein Typ gefragt. Eine Frau sucht eine neue Wohnung, die alte ist wegen des Hochwassers gerade nicht bewohnbar. Sie will unbedingt hier bleiben, damit die Tochter nicht die Schule wechseln muss. Sie klingt verzweifelt, beginnt zu weinen. Mainzer sagt gar nicht viel, aber er verspricht sich umzuhören. Die Frau schreibt ihren Namen und ihre Telefonnummer auf seinen Notizblock. Fragen kann er zum Beispiel die Ehrenamtlerin, die auch beim WEISSEN RING arbeitet und sich in der Gegend momentan um Wohnraum für Flutopfer kümmert. Den Antrag auf Soforthilfe hat die Frau auch noch nicht ausgefüllt. Kann sie gleich hier machen. Mainzer setzt sich mit ihr auf eine Bank. Zum Abschied umarmt sie ihn, und zum ersten Mal an diesem Tag wirkt Mainzer ein klein wenig unbeholfen.
Sebastian Dalkowski
















(Fotos: Thomas Banneyer)





