Wenn Sina (Anmerkung: Sina möchte anonym bleiben und nur mit Vornamen genannt werden) einen Film sieht, in dem etwas vorkommt, das sie triggert, kann es sein, dass sie blitzartig in eine Erinnerung zurückgeworfen wird, die sie eigentlich lieber vergessen würde. „Ich bin dann in einer Szene aus meiner Vergangenheit gefangen, manchmal zwei oder drei Stunden in Endlosschleife.“ Wenn es aufhört, ist sie erschöpft, manchmal fühlt sie sich losgelöst von ihrem Körper, später hat sie Albträume. Die Nachwirkungen können noch ein bis zwei Tage andauern. Sina leidet unter PTBS – einer Posttraumatischen Belastungsstörung – aufgrund traumatischer Erfahrungen mit Missbrauch in ihrer Kindheit.
Um Menschen wie Sina vor solchen Flashbacks oder anderen negativen Reaktionen zu schützen, nutzen Medienschaffende seit einiger Zeit sogenannte Triggerwarnungen. Sie sollen auf das vorbereiten, was Hörer oder Zuschauerinnen in einem Film, einer Sendung oder einem Podcast erwartet, so dass diese selbst entscheiden können, ob sie sich ein Thema zumuten wollen oder nicht. Die Warnungen werden oft am Anfang einer Sendung ausgesprochen, bei Videos eingeblendet, oder es wird darauf verwiesen, dass es in den Folge-Notizen mehr Informationen zu möglicherweise triggernden Inhalten gibt.
Trigger ist ein Begriff aus der Psychologie. Gemeint ist damit ein „Auslöse-Reiz“, der bei Betroffenen von Traumafolgestörungen wie der PTBS bestimmte Erinnerungen und Reaktionen hervorrufen kann. Dass das möglich ist, hängt damit zusammen, was bei einem existenziell bedrohlichen Erlebnis im Gehirn abläuft: eine Art Notfallprogramm. Es geht nur noch ums Überleben – der Verstand leitet nicht mehr das Handeln. Dadurch entsteht eine Blockade bei der Verarbeitung von Informationen.
Von Erinnerungen „überflutet“

Anders als sonst könne das Gehirn nicht mehr zwischen Denken und Fühlen wechseln, der „Verstand“ werde abgespalten, sagt Thomas Weber, Leiter des Zentrums für Trauma- und Konfliktmanagement (ZTK) in Köln. Das kann Folgen haben. „Durch diese Abspaltung wird eine ‚normale‘ Verarbeitung der Wahrnehmung, Erinnerung und der Gefühle, die ein Betroffener während der Situation gehabt hat, verhindert“, so Weber. Oft berichteten Betroffene später, dass sich das Erlebnis für sie unwirklich angefühlt habe oder sie den Eindruck hatten, von außen zugesehen zu haben. Auch die zeitliche Wahrnehmung gerate immer wieder durcheinander. Dadurch, dass die Eindrücke und Gefühle in diesem Moment nicht verarbeitet werden können, kann * Sina möchte anonym bleiben und nur mit Vornamen genannt werden. es sein, dass das Gehirn später durch Reize von außen, eben besagte Trigger, ganz plötzlich von Erinnerungen „überflutet“ werde – durch Flashbacks, Gedankenfetzen oder vor dem inneren Auge ablaufende Filme.
Das soll in den Medien durch Triggerwarnungen vermieden werden. Die Ursprünge liegen in den frühen 2000er-Jahren. Verwendet wurden sie von Betroffenen von sexualisierter Gewalt, die sich in Foren im Internet miteinander über ihre Erfahrungen ausgetauscht haben. Mittlerweile tauchen sie an vielen Stellen auf. Auf Tiktok, Facebook und Instagram, auf YouTube und in Podcasts heißt es dann etwa: „Achtung, Triggerwarnung: In dieser Folge geht es um Kindesmissbrauch.“ Oft sind auch die genauen Stellen angegeben, an denen es um das möglicherweise belastende Thema geht. Oder es heißt: „Wenn es dir mit diesem Thema nicht gut geht, überspringe die Folge lieber.“
Menschen, die von PTBS betroffen sind, sollen selbst entscheiden können, ob sie sich ein Thema in einem Video oder Podcast zumuten wollen oder können. Doch obwohl dieser Gedanke zunächst gut klingt, sind sich Fachleute und Forschende nicht einig, ob diese Warnhinweise wirklich sinnvoll sind oder ob sie nicht den Betroffenen sogar mehr schaden als nutzen.
Thomas Weber etwa sieht sie skeptisch. „Trauma ist Kontrollverlust. Ziel der Therapie ist es, Kontrolle zurückzugewinnen“, sagt er. Wird in einer Triggerwarnung deutlich davon abgeraten, bestimmte Inhalte anzusehen oder anzuhören, werde damit den Betroffenen wieder Kontrolle entzogen. Außerdem sei das Vermeiden eher ein Symptom von PTBS als ein guter Weg, damit umzugehen. „Traumatherapie ist wie ein Pendeln zwischen Zulassen und Vermeiden“, sagt Weber. Es gehe darum, sich langsam und in sicherer Umgebung immer mehr mit dem Trauma zu konfrontieren und die Informationen, die falsch oder gar nicht verarbeitet wurden, aufzulösen.
Nutzen nicht nachweisbar
Auch wissenschaftliche Studien konnten den Nutzen von Triggerwarnungen bislang nicht nachweisen – eher im Gegenteil. Die Untersuchungen waren meist ähnlich aufgebaut: Personen wurden in zwei Gruppen eingeteilt und mussten verschiedene Arten von Inhalten ansehen – etwa literarische Texte, Fotos, Zeitungsartikel oder kurze Videos. Den Teilnehmenden der einen Gruppe wurde vorab eine Triggerwarnung angezeigt, denen der anderen nicht. Untersucht wurden dann unterschiedliche Dinge. Etwa, wie ängstlich die Personen sich vor, während und nach dem Lesen des Hinweises gefühlt haben. Andere Studien untersuchten, ob die Teilnehmenden nach der Warnung den folgenden Inhalt ansehen wollten oder nicht – oder auch, wie negativ sie das Folgende einschätzten. Mevagh Sanson von der Victoria-Universität in Wellington, Neuseeland, fasst in einem Artikel die Ergebnisse vieler verschiedener Studien zusammen. Man habe herausgefunden, dass Menschen die Warnhinweise nicht wirklich nutzten, um bestimmten Inhalten aus dem Weg zu gehen. Außerdem hätten die wenigsten angegeben, sich nach so einem Hinweis weniger gestresst oder ängstlich zu fühlen – also beruhigt und besser auf das Folgende vorbereitet. Und: Viele Menschen fänden die Warnungen selbst schon beängstigend oder verstörend.
Obwohl Wissenschaft und Traumatherapie also eher skeptisch gegenüber der Wirksamkeit von Triggerwarnungen sind, sehen Betroffene das immer wieder auch anders. Sina zum Beispiel ist oft froh über die Hinweise. „Ich kann damit besser einschätzen, was mich erwartet, und überlegen, ob ich mich dafür gerade stabil genug fühle“, sagt sie. Sina leitet eine PTBS-Selbsthilfegruppe der Jungen Selbsthilfe in Aachen in Nordrhein-Westfalen. Auch in ihrer Gruppe gibt es verschiedene Perspektiven. Eine Person empfindet die Warnungen als inklusiv – sie ermöglichen ihr zufolge Teilhabe, weil Traumabetroffene dadurch nicht mehr grundsätzlich bestimmte Medien meiden müssen.

Eine andere Person aus der Gruppe weist aber auf ein anderes Problem hin: Trigger sind sehr individuell und nicht unbedingt nur mit der konkreten Erzählung von bestimmten Taten oder Themen verbunden. Die Person beschreibt, dass sie viele ihrer Trigger nicht kennt, aber auch, dass die, die ihr bekannt sind, oft Dinge sind, die von anderen als unproblematisch wahrgenommen werden. Und vor denen könne natürlich nicht gewarnt werden.
Was Sina und andere aus der Selbsthilfegruppe aber besonders stört: dass Worte wie Trigger und Trauma mittlerweile in der Alltagssprache genutzt werden. „Viele meinen mit dem Ausdruck ‚das triggert mich‘ eigentlich ‚das nervt mich‘. Ich finde das völlig daneben“, sagt Sina. Es verwässere das eigentliche Problem, das Menschen haben, die tatsächlich von Trauma und der Wirkung von Triggern betroffen sind. Dass diese Begriffe mittlerweile auch losgelöst von psychologischen Phänomenen benutzt werden, hat auch Auswirkungen auf die Warnungen. Immer wieder werde auch vor Dingen gewarnt, die eher nicht im Traumakontext relevant sind, sondern die von Menschen als unangenehm empfunden werden könnten – wie zum Beispiel, dass in einem Film zu sehen ist, wie sich eine Person erbricht.
Während eine Zeitlang mehr und mehr Triggerwarnungen ausgesprochen wurden, scheint der Trend mittlerweile aber wieder zurückzugehen – oder sich zumindest der Umgang damit zu verändern. So zum Beispiel beim YouTube-Format „Die Frage“ von funk, dem ContentNetzwerk von ARD und ZDF, produziert vom Bayerischen Rundfunk. „Die Frage“ behandelt oft Themen, wie Gewalt in der Familie, psychische Erkrankungen, Suizid oder Sterbehilfe. Vor einiger Zeit waren die Warnhinweise dort noch recht deutlich – mittlerweile ist das anders.
Teresa Fries und Diana Kulozik leiten das Team von „Die Frage“. In der Community habe es den Wunsch gegeben, bei besonders schwierigen Themen eine Triggerwarnung auszusprechen. „Wir haben dann geschaut, was wünschen sie sich, was sind sie gewohnt, und wie gehen andere damit um“, sagt Teresa Fries. Deshalb habe man zunächst eine recht deutliche Warnung ausgesprochen, diese auch Triggerwarnung genannt und auch eine Handlungsempfehlung mitgegeben: „Wenn es dir mit diesem Thema nicht gut geht, schau dir dieses Video besser nicht an oder zumindest nicht allein.“

Bei der Arbeit an den Videos ist die Redaktion oft im Gespräch mit Betroffenen, aber auch mit Psychologinnen und Therapeuten. Die verschiedenen Perspektiven, die die Redaktion dadurch gewonnen hat, haben dazu geführt, die Hinweise zu Beginn der Folgen anzupassen. Entscheidend sei dabei etwa die Info gewesen, dass das Wort Triggerwarnung selbst triggern kann. Oder die Erkenntnis, dass so eine Warnung nicht unbedingt dazu führt, dass bestimmte Menschen die Inhalte nicht ansehen, sondern sogar erst recht. Und auch, wie vielfältig Trigger sein können – dass eben nicht nur das Nacherzählen etwas auslösen kann, sondern auch die Darstellung von Blaulicht oder auch ganz andere Dinge.
„Der größte Punkt war aber, dass den Betroffenen je nach Formulierung auch ein bisschen Selbstbestimmung genommen wird oder sie sich bevormundet fühlen könnten“, sagt Teresa Fries. Etwa wenn deutlich vom Ansehen abgeraten wird. Deshalb formulieren sie die Hinweise jetzt anders. Zu Beginn einer Folge heißt es nun ganz neutral: „In dieser Folge geht es um …“ Ohne Handlungsempfehlung oder Betonung, wie belastend das Thema sein könnte. So könne jede und jeder selbst überlegen, ob er oder sie gerade Lust auf das Video hat oder eben nicht. „Betroffene können selbst entscheiden, was sie sich wann zutrauen – dazu brauchen sie niemanden, der sagt: Du aber nicht“, sagt Diana Kulozik.
In der Videobeschreibung werden manchmal noch Stellen angegeben, die besonders intensiv sein könnten. So könnten Zusehende auch entscheiden, diese zu überspringen, den restlichen Film aber trotzdem ansehen. Oft gibt es in der Beschreibung auch Kontaktdaten von Hilfestellen und Beratungsangeboten für Menschen, die in einer Krise stecken oder denen es psychisch nicht gut geht.
In manchen Fällen hält auch Thomas Weber die Hinweise für sinnvoll – so bei ganz expliziter Gewalt oder der Darstellung von Krieg oder Rassismus. Besonders wenn Titel oder Genre nicht erwarten lassen, dass ein derartiger Inhalt folgt. Von einem Trigger überrascht zu werden, sei für die Betroffenen ansonsten zwar unangenehm, müsse aber auch nicht nur negativ sein. „Für Menschen in Traumatherapie kann das Getriggertwerden auch ein Indikator sein und sie erkennen lassen, wo noch ein wunder Punkt liegt, an dem sie noch weiterarbeiten sollten“, sagt Thomas Weber. Ziel der Therapie sei es, auf lange Sicht, wieder durchs Leben gehen zu können, ohne sich vor Triggern fürchten zu müssen.
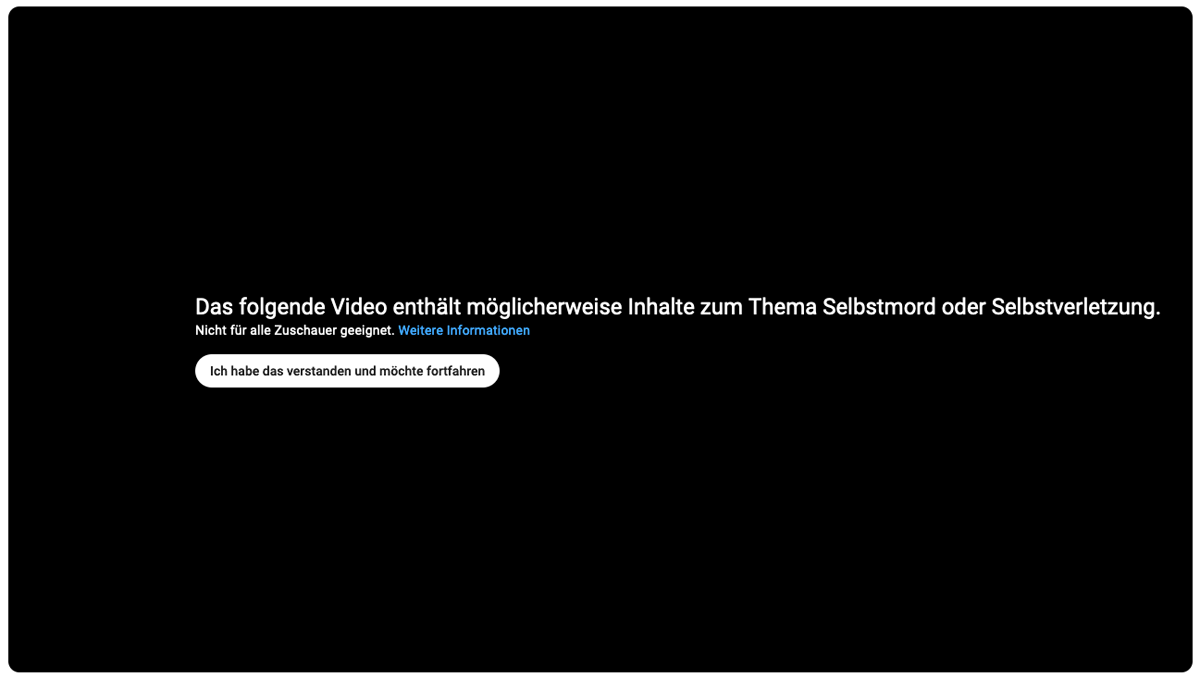
Zum Teil nehmen die Plattformen bei bestimmten Inhalten den Urhebern die Entscheidung aber mittlerweile sogar ab. Bei einem Video von „Die Frage“ zu Sterbehilfe hat YouTube selbst einen Hinweis vorgeschaltet: „Das folgende Video enthält möglicherweise Inhalte zum Thema Suizid oder Selbstverletzung. Nicht für alle Zuschauer geeignet.“ Um das Video anzusehen, muss man aktiv auf den Button „Ich habe das verstanden und möchte fortfahren“ klicken.
Auch Sina möchte selbst bestimmen können, wann sie bei einem Film oder einem Podcast dranbleibt und wann sie lieber ausschaltet. Triggerwarnungen, in denen deutlich abgeraten wird, weiterzuschauen oder -hören, findet auch sie daher fehl am Platz. Trotzdem helfen die Hinweise bei ihrer Entscheidung. Sie sieht sich gerne Krimis an oder hört mal einen True-Crime-Podcast. Den Inhalten, die für sie schwierig sind, geht sie auch nicht grundsätzlich aus dem Weg. Es gehe eher darum, an Tagen, die schon zu voll waren, sagen zu können: „Heute besser nicht.“
Carolin Scholz
Transparenzhinweis: Die Redaktion des WEISSEN RINGS hat die Begriffe „Triggerwarnung“ oder „Content-Note“ zum Beispiel in ihrem Audioformat #WRstory oder auf Social-Media-Kanälen verwendet. Mittlerweile wird darauf verzichtet, stattdessen wird wie empfohlen mit Einleitungen gearbeitet wie: „In diesem Beitrag geht es um…“





