Herr Ziercke, Sie waren lange der oberste Polizist in Deutschland. Nach Ihrem Abschied als BKA-Chef hätten Sie den verdienten Ruhestand genießen können – stattdessen engagierten Sie sich beim WEISSEN RING für Kriminalitätsopfer. Warum?
In meinen 47 Jahren im Polizeidienst habe ich immer wieder gemerkt, dass wir zwar dem Täter sehr viel Zeit widmen, aber diese Zeit nicht für die Opfer aufbringen. Die Polizei hat nicht nur eine repressive Aufgabe, sondern vor allem auch eine präventive. Der präventive Opferschutz ist schon seit Anfang der 90er Jahre mein Thema gewesen, mit der Gründung des Deutschen Forums für Kriminalprävention, wo ich dabei sein durfte, und beim Aufbau der kommunalen kriminalpräventiven Räte in Deutschland. Als der WEISSE RING dann auf mich zukam und anbot, das Thema in den Ruhestand mitzunehmen, war für mich klar, dass das ein Unruhestand wird: für die Opfer etwas zu erreichen, was ich in meinem Amt nicht habe erreichen können.
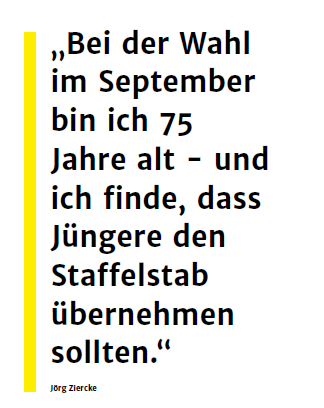
Nach vier Jahren als Bundesvorsitzender haben Sie sich jetzt entschieden, nicht wieder zu Wahl anzutreten. Haben Sie denn alles erreicht für die Opfer, was Sie erreichen wollten?
Nein. Ich glaube aber, dass wir mit dem neuen Sozialgesetzbuch XIV, dem Übergang vom Opferentschädigungsgesetz ins Soziale Entschädigungsrecht, sehr viel erreicht haben. Es war uns ein ganz wichtiges Anliegen, eine angemessene Versorgung zu ermöglichen auch für diejenigen, die durch Gewalt schwerste Schäden erleiden. Es ist uns aber von der Politik viel versprochen worden an Erleichterungen, was die Antragsstellung angeht und was die Verfahrensabläufe angeht. Diese Ziele haben wir nicht erreicht, das wird weiterhin eine wichtige Aufgabe sein für den WEISSEN RING. Dass ich jetzt aufhöre, hat einfach mit dem Alter zu tun. Bei der Wahl im September bin ich 75 Jahre alt – und ich finde, dass Jüngere den Staffelstab übernehmen sollten. Als Berater stehe ich natürlich gern weiter zur Verfügung.
Sie sprechen das Soziale Entschädigungsrecht an. Warum sind Sie nicht zufrieden, was muss sich dringend ändern?
Ich bin deshalb nicht zufrieden, weil sich schon in den Vorbesprechungen immer wieder gezeigt hat, wie groß der Einfluss der Bürokratie ist auf das, was die politisch Handelnden wollen. Wir sind in der Diskussion teilweise nur schrittweise vorangekommen, weil immer wieder neue Hinweise aus der Bürokratie kamen: Dies geht nicht, das geht nicht, jenes wollen wir nicht. Die 16 Bundesländer waren sich zum Beispiel nicht einig, ob man Clearingstellen einrichten soll. Diese Stellen sollen den Opfern helfen: Wenn eine Entscheidung negativ ausfallen könnte, soll sich zunächst eine Clearingstelle mit externen Fachleuten der Sache annehmen und prüfen, ob die Entscheidung auch gerechtfertigt ist. Im Grunde glaubt Bürokratie den Opfern nicht.
Anders als der WEISSE RING.
Wir glauben den Opfern ganz grundsätzlich. Bürokratie geht da kritisch ran: Das Opfer hat die Beweislast, festzustellen, zu belegen, nachzuweisen, was passiert ist. Und das endet dann manchmal eben auch so, dass die Bürokratie sagt: Ja, dann sollen die Opfer doch vor Gericht gehen, dann warten wir mal das Urteil ab. Aber das wird traumatisierten Opfern nicht gerecht! Im Strafverfahren hat der Täter das letzte Wort. Und ein Gericht muss im Zweifel für den Angeklagten entscheiden, das ist ein wichtiger Rechtsgrundsatz. In den Sozialbehörden in Deutschland wird allerdings im Zweifel gegen das Opfer entschieden. Hier braucht es einen Paradigmenwechsel: Bürokratie sollte grundsätzlich dem Opfer glauben und nicht grundsätzlich an ihrer Aussage zweifeln.
Das heißt, die Kultur in Behörden muss sich ändern?
Deutlich! Das, was der WEISSE RING jetzt mit seinem Ländervergleich zutage gefördert hat, ist aus meiner Sicht ein Beleg für die Unterschiedlichkeit der Auslegung von Gesetzen in den Behörden: So gravierend jeder Einzelfall ist, so unverständlich muss es jedem Opfer vorkommen, dass man in einem Bundesland zu 50 Prozent Erfolg mit seinem Antrag hat und in einem anderen nicht annähernd. Das ist der eine Punkt, um den es geht. Der zweite Punkt ist, dass die Politik die Aufgabe hat, dass dieses Gesetz in der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. Vor den rund 200.000 Gewaltdelikten, die wir in Deutschland haben, gefährliche Körperverletzung, Raubüberfälle, schwerste Verletzungen, folgen nur in etwa zehn Prozent der Fälle Anträge auf Unterstützung bei den Sozialbehörden.
Und es gibt noch einen dritten Punkt. In den Ländern gibt es neben Anerkennungen und Ablehnungen auch noch die Kategorie „Erledigungen aus sonstigen Gründen“. Dahinter verbergen sich nach meiner festen Überzeugung zu einem großen Teil Fälle, in denen es die Menschen leid sind, die Beweisanforderungen zu erfüllen, die immer wieder mit gutachterlicher Tätigkeit, mit Stellungnahmen, mit schriftlichen Eingaben verbunden sind, zumal sich das Verfahren oft erheblich in die Länge zieht. Es dauert Wochen, Monate oder Jahre, so dass die Menschen am Ende erschöpft und enttäuscht sind und dann von sich aus nicht mehr weitermachen. Das heißt, wenn man die Zahl dieser Rückzüge genauer fassen könnte, dann ist die Zahl der Menschen, die Entschädigung erhalten, noch niedriger. Ich behaupte, dass von den rund 200.000 Gewaltfällen, die wir in Deutschland im Jahr haben, nur drei bis vier, vielleicht fünf Prozent Opfer wirklich Leistungen durch den Staat erhalten. Und das, finde ich, ist ein Skandal, der durch die Bürokratie mit verursacht wird.
Im Opferentschädigungsgesetz steht: Der Staat verpflichtet sich, seine Bürger zu schützen – und in den Fällen, wo er es nicht konnte, verspricht er, für ihre Versorgung einzustehen. Kommt der Staat dieser Verpflichtung nach?
Der Staat kommt seiner Verpflichtung eindeutig nicht nach. Das zeigen unsere Recherchen. Ich unterstelle kein absichtsvolles Verhalten des Staates oder der Politik. Die Bürokratie ist nicht entsprechend vorbereitet auf den Umgang mit einem problematischen Rechtsbereich auf der einen Seite und mit Problemen auf der anderen Seite, die der Mitarbeiter möglicherweise mit dem traumatisierten Antragsteller hat. Deshalb glaube ich, dass ein Paradigmenwechsel erforderlich ist. Es braucht eine klare Ansage der Politik, dass bei Zweifeln Externe hinzugerufen werden und dass ein verpflichtender Zeitrahmen festgelegt wird, in dem der Antrag abgearbeitet sein muss. Man darf die Betroffenen nicht endlos hinhalten. Dafür kämpfen wir beim WEISSEN RING.
Sie sind angetreten beim WEISSEN RING mit dem Vorsatz, das Ehrenamt zu stärken und Nachwuchs zu finden. Was hat sich da getan?
Das Problem, vor dem nicht nur wir als Opferhilfeverein stehen, sondern alle Vereine oder Parteien, ist ja, dass sich der Einzelne heute nicht mehr so stark binden will, sondern offener und freier handeln möchte. Die Mitgliedschaft in Vereinen und Parteien ist deutlich zurückgegangen in Deutschland, und darunter leiden wir natürlich auch. Auf der anderen Seite steht das Engagement der ehrenamtliche Helfer natürlich im Zentrum unserer Bemühungen. Das ist eine große Anstrengung, die wir unternehmen. Es gelingt uns, Gott sei Dank, die etwa 3000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die der WEISSEN RING hat, auf diesem Niveau zu halten, sie auszubilden und Nachwuchs zu finden. Es gibt aber auch Menschen, die weder ehrenamtlich arbeiten noch Mitglied sein wollen, die aber mit Geld helfen möchten. Und da muss ich sagen: Die Spendenbereitschaft in Deutschland ist enorm. Beim WEISSEN RING haben wir die Situation, dass wir auf der einen Seite viel Zuwachs haben im Bereich der Vermächtnisse, also der testamentarischen Zuwendungen, auf der einen Seite aber eben auch von 120.000 bis 150.000 Menschen jährlich Geld als Spende bekommen. Und trotz der zwangsläufig rückläufigen Mitgliederzahl – wir waren mal bei etwa 65.000 Mitgliedern Anfang der 90er Jahre, heute sind wir bei 42.000 – sind die Zuwendungen von Mitgliedern gestiegen. Die Menschen sind bereit, Geld zu spenden. Hier hilft uns der gute Ruf des WEISSEN RING natürlich ganz enorm.
Stichwort Spenden: Der WEISSE RING betont immer wieder seine Unabhängigkeit von Staat und Politik und vor allem von staatlichen Zuwendungen. Warum ist das so wichtig für den Verein?
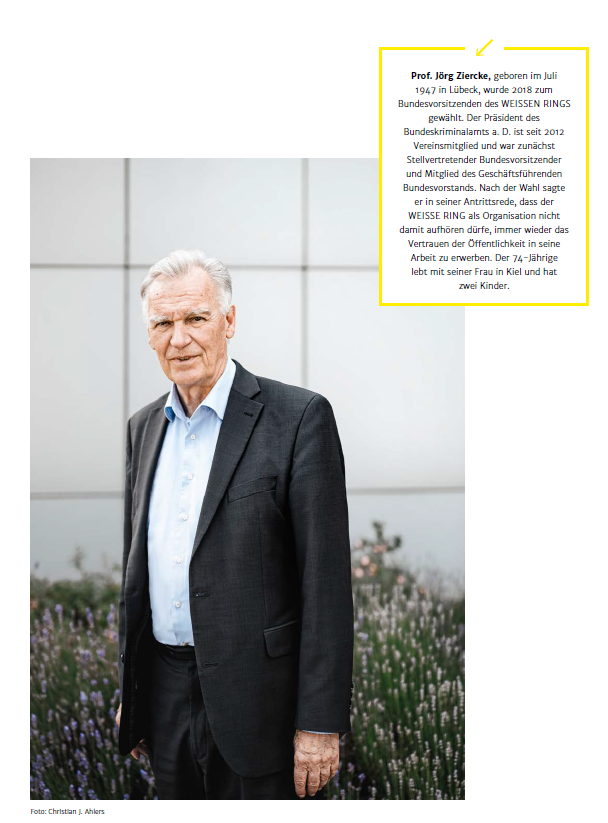
Wie wichtig das ist, haben wir in der Debatte über das neue Soziale Entschädigungsrecht sehr deutlich erlebt. Wir waren bevorzugter Gesprächspartner der Bundesregierung. Ich hatte selbst die Gelegenheit, im Bundeskanzleramt über diese Probleme zu sprechen. Und da wurde schon deutlich, welchen Stellenwert wir als ehrenamtliche Organisation haben. Da wir keine Zuschüsse vom Staat nehmen, muss sich der Staat umso mehr mit uns ins Benehmen setzen. Unsere Unabhängigkeit ist ein wichtiges Pfund, mit dem wir wuchern können: Wir können frei entscheiden, was wir berichten, wie wir berichten, wie wir dokumentieren, wie wir die Dinge ansprechen. Wir müssen es nur selbst verantworten können. Wir müssen nicht auf irgendeine Partei oder auf irgendeinen Politiker Rücksicht nehmen. Ich glaube, dass wir da den richtigen Ton finden. Mein Eindruck ist, dass unsere Berichte und Veröffentlichungen große Anerkennung finden. Unsere Veröffentlichungen zum Thema Femizide haben zum Beispiel hervorragende Wirkung erzeugt.
Zum Thema Femizid hat der WEISSE RING nicht nur eine umfangreiche Recherche veröffentlicht. Sie haben direkt im Anschluss einen Brandbrief an hochrangige Politiker verschickt, in dem Sie sofortiges Handeln zum Schutz von Frauen forderten. Warum war das notwendig?
Wenn im Jahr etwa 115 Frauen getötet werden durch Partner oder Ex-Partner, dann kann das niemanden kaltlassen. Ich bin vor einigen Monaten angesprochen worden von einer Frau, die in der Nähe von Kiel lebt, deren Tochter und Enkel auf offener Straße in Freiburg erstochen worden sind durch den Ex-Partner der Frau. Der Täter stammte aus einem islamischen Kulturkreis. Da haben Sie ein Thema, das in der Öffentlichkeit völlig kontrovers diskutiert wird. Nach unserer Veröffentlichung haben wir zahlreiche Rückmeldungen bekommen. Nach diesem Interview werden wir heute dazu noch ein Gespräch mit der Sozialministerin in Rheinland-Pfalz führen, auch anderweitig habe ich solche Gespräche schon geführt. Und dann hört man immer wieder: Ja, was sollen wir denn tun?
Was soll die Politik denn Ihrer Meinung nach tun?
Was sie tun sollte ist erstens, nicht darauf zu vertrauen, dass diejenige Frau, die zu Gericht geht und dort ein Verbot erreicht, laut dem sich der Mann ihr und ihrem Kind nur auf 200 Meter annähern darf, dadurch geschützt ist. Ein solches Verbot braucht Überwachung und Überprüfung. Wenn am Ende die Tötung oder die schwere Verletzung eines Menschen stehen kann, dann ist es durchaus verhältnismäßig, demjenigen, für den das Verbot gilt, bestimmte Einschränkungen zuzumuten, zum Beispiel durch eine Fußfessel. Zweitens sollte man nicht glauben, allein durch eine Gefährderansprache der Polizei jemanden von einer Tat abhalten zu können. Wobei der größte Witz ja eigentlich ist, dass der Gefährder gar nicht kommen muss, wenn die Polizei ihn zu einer Gefährderansprache einlädt. Das heißt, es braucht von polizeilicher Seite ein Hochrisikomanagement. In Deutschland gibt es so etwas nur in wenigen Ländern, es gibt kein gemeinsames Konzept der Bundesländer. Diese Forderung stelle ich: dass man bundesweit ein Risikomanagement für solche Fälle einrichtet, wo dann nicht nur Polizei entscheidet, sondern auch Experten aus Jugendamt, Sozialbehörde, Justiz, Psychologie beteiligt sind. Es wird kein hundertprozentiger Schutz möglich sein. Aber Maßnahmen wie zum Beispiel das Interventionsprogramm RIGG in Rheinland-Pfalz zeigen, dass die Fallzahlen deutlich zurückgegangen sind. Das macht Mut.
Glauben Sie, dass es eine wichtige Aufgabe für eine Institution wie den WEISSEN RING ist, solche umfassenden Recherchen wie zu Femiziden oder zum Opferentschädigungsgesetz anzustellen? Um damit in Lücken zu stoßen, die andere nicht ausfüllen, und um Fakten an die Politik heranzutragen?
Bei mir ist diese Erkenntnis immer stärker gewachsen im Laufe der Zeit – weil diese Recherchen ja kein anderer anstellt. Wir haben zum Glück die Mittel, um das zu tun. Es ist eine ganz wichtige Aufgabe des WEISSEN RINGS, diese Dinge der Politik gegenüber so praktisch zu erklären, dass sie daraus Schlussfolgerungen ziehen kann. Das ist keine Parteipolitik, das ist Opferpolitik.
Wie politisch darf und muss ein Opferhilfeverein sein? Oder anders gefragt: Wie unbequem darf und muss er sein?
Die Frage, wie politisch und auch unbequem wir sein dürfen, haben wir ja sehr deutlich beim Thema AfD gespürt…
… Sie meinen den sogenannten AfD-Beschluss des Bundesvorstands zu Beginn Ihrer Amtszeit, laut dem niemand ehrenamtlich oder hauptamtlich für den WEISSEN RING arbeiten darf, der in einer fremdenfeindlichen oder antisemitischen Bewegung aktiv ist, und laut dem der WEISSE RING auch keine Spenden von der AfD annimmt …
… genau. Die AfD hatte sich auf sehr undemokratische Weise unseres Images bemächtigt, indem man an einen politischen Stand das Logo des WEISSEN RINGS angebracht hatte und die Aussage „Wir sammeln für den WEISSEN RING“. Dafür hatten wir keine Zustimmung geben. Uns war klar, dass wir das nicht einfach so laufen lassen können, dass wir mit unserem guten Ruf vereinnahmt werden für eine politische Absicht. Wir grenzen uns ganz klar von denen ab, die kein wirklich demokratisches Profil haben als Partei. Wir sind ansonsten parteipolitisch neutral, aber es geht nicht, wenn Werte, die uns wichtig sind, wie zum Beispiel Antidiskriminierung, mit Füßen getreten werden von Vertretern einer Partei. Und dafür muss sich die Partei insgesamt in die Verantwortung nehmen lassen, wenn sie das nicht abstellen kann. Und die AfD kann dies offensichtlich nicht.
Der WEISSE RING hatte 2001 das Jahresthema „Hass und Hetze“ gewählt und in zahlreichen Veröffentlichungen die Verrohung der Gesellschaft thematisiert. Die kritische Auseinandersetzung mit Hass und Hetze vor allem von Rechts fand Beifall, stieß aber auch auf Widerspruch bei Mitgliedern und führte sogar zu Vereinsaustritten. Muss ein Verein auch so etwas aushalten?
Auf jeden Fall. Wir müssen es aushalten können, dass Menschen zu uns kommen und sich auch wieder von uns trennen. Wir laufen hinter niemandem her, wir wollen für die Opfer möglichst viel erreichen. Und insofern müssen Menschen, die mit unserem Verhaltenskodex sich nicht in Übereinstimmung befinden, auch nicht zum WEISSEN RING kommen.
Zu Beginn Ihrer Amtszeit gab es nicht nur die Diskussionen um den AfD-Beschluss, der WEISSE RING erlebte eine ernste Krise: Es gab Vorwürfe gegen einen ehrenamtlichen Mitarbeiter in Lübeck, sich sexuell übergriffig gegenüber Frauen verhalten zu haben und später einen weiteren Fall mit Missbrauchsvorwürfen gegen einen ehrenamtlichen Mitarbeiter im Hochsauerlandkreis. Der Verein hat daraufhin die Regeln zur Betreuung weiblicher Opfer deutlich verschärft und unter anderem ein strenges Sechs-Augen-Prinzip eingeführt. Das führte zu Protesten einiger zumeist männlichen Ehrenamtlichen, einige legten ihr Amt nieder. Wie sehr hat das Verein getroffen?
Dass Opferhelfer ihre Position missbrauchen gegenüber einem Kriminalitätsopfer und es ein zweites Mal zum Opfer machen, ist das natürlich völlig indiskutabel und muss sofort zu einer Reaktion der Verantwortlichen des WEISSEN RINGS führen. Ich glaube, darüber sind sich auch alle im Verein im Klaren. So haben wir in diesen Fällen in Lübeck und im Hochsauerland natürlich entschieden, dass diese Mitarbeiter den Verein sofort verlassen mussten. Aber wir haben auch entschieden, dass wir verstärkt Sicherungen einbauen müssen. Einen hundertprozentigen Schutz kann man niemandem versprechen, aber man kann etwas tun. Deshalb haben wir gesagt, wir müssen die Begegnungssituation so gestalten, dass einerseits Frauen geschützt sind, andererseits auch dem Opferhelfer kein Vorwurf gemachen werden kann. Das hat im WEISSEN RING erstaunlicherweise insbesondere bei einigen älteren Mitarbeitern dazu geführt, dass die gesagt haben: Der Vorstand vertraut uns nicht mehr. Ich habe das mal mit dem Strafgesetzbuch verglichen: In den 300 Paragrafen steht, dass wir alle nicht einbrechen dürfen, nicht vergewaltigen dürfen, nicht körperverletzen dürfen, ohne dass sich davon jemand diskriminiert fühlt. Genau das machen wir hier auch: Wir stellen eine Regel auf und sagen, wir möchten, dass wir uns in diesem Fall so oder so verhalten. Mehr sagen wir damit nicht.
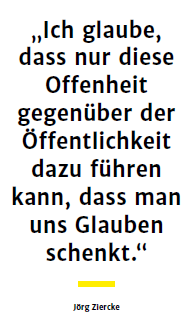
Als der Verein im Februar 2021 von den Missbrauchsvorwürfen gegen den Mitarbeiter im Hochsauerlandkreis erfuhr, haben Sie etwas Ungewöhnliches getan: Der WEISSE RING hat entschieden, selbst eine Pressemitteilung zu veröffentlichen und den Fall auf einer immer wieder aktualisierten Internetseite transparent aufzubereiten. Warum haben Sie selbst den Blick der Öffentlichkeit auf den Fall gelenkt?
Ich glaube, dass nur diese Offenheit gegenüber der Öffentlichkeit dazu führen kann, dass man uns Glauben schenkt. Dass man uns vertraut in dem, was wir tun. Dieses Vertrauen ist das höchste Gut, das wir gegenüber Opfern haben. Deshalb haben wir gesagt: Wir erstatten Selbstanzeige, wir suspendieren sofort den Mitarbeiter, wir gehen mit aller Transparenz in die Öffentlichkeit. Wir wollten unser Wissen teilen. Gleichwohl war das ein neuer Weg, diese Art von Offenheit waren auch wir nicht gewohnt. Aber wir haben uns überzeugen lassen von unserem Presseteam. Ein Punkt, der mich überzeugt hat: In der Öffentlichkeit kommt oft schnell der Verdacht eines Systemversagens auf. Diesen Verdacht kann man nur durch Offenheit und Transparenz ausräumen.
Welche Rolle spielen für Sie die Sozialen Medien, wenn es darum geht, den WEISSEN RING und seine Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen?
Wir müssen uns dem Informations- und Kommunikationsverhalten der Bevölkerung in den verschiedenen Altersgruppen viel stärker anpassen. Wenn sich weite Teile der Menschen heute nicht mehr aus der Zeitung informieren, sondern über das, was in Social Media dargestellt wird, dann müssen wir da mit am Ball sein. Und das sind wir auch. Es geht ja nicht nur darum, Informationen zu vermitteln, sondern auch darum Menschen anzusprechen, sei es als ehrenamtliche Helfer, als Spender, als Mitglieder. Wenn es darum geht, dass Opfer den WEISSEN RING um Hilfe bitten, geht es letztlich immer um Vertrauen. Das ist unser entscheidendes Kapital, dass wir auch über die digitalen Kanäle aufbauen.
Digitaler wird auch die Bundesdelegiertenversammlung des WEISSEN RINGS im September in Radebeul: Gewählt wird nicht mehr mit Stimmzetteln, sondern zum ersten Mal mit Tablets. Ist das ein Zeichen dafür, dass der WEISSE RING sich für das digitale Zeitalter richtig aufstellt?
Der WEISSE RING muss, was die Modernisierung angeht, ganz klar auf Digitalisierung setzen. Wenn man Digitalisierung sagt, muss man aber auch Sicherheit mitdenken. Gerade wir haben es ja mit hochsensiblen Daten zu tun. Das Wissen um diese Zusammenhänge muss heute jeder Mitarbeiter mitbringen. Die Pandemie hat ja gezeigt, wie sich Arbeit verändert. Wenn wir teilweise im Homeoffice arbeiten und teilweise im Büro, dann müssen wir realisieren, dass die Sicherheit der Daten an allen Orten gewährleistet ist.

Gibt es etwas, das Sie Ihrer Nachfolgerin, Ihrem Nachfolger gern mit auf dem Weg geben möchten?
Ich würde mir wünschen, dass der WEISSE RING den eingeschlagenen Weg weitergeht, etwa im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Dass immer wieder nach neuen Themen geforscht wird, die den Opfern zugutekommen. Ich wäre auch sehr dafür, dass wir Themen wie die soziale Ungerechtigkeit, über die wir beim Opferentschädigungsgesetz gesprochen haben, wissenschaftlich aufbereiten. Auf der anderen Seite war es für mich eine wichtige Erkenntnis, dass ein ehrenamtlicher Verein keine Behörde ist, wo von oben nach unten eine Weisung erteilt werden kann. Jeder ehrenamtliche Mitarbeiter gibt uns seine Freizeit, sein Engagement, das müssen wir zuerst einmal anerkennen. Das Ziel kann deshalb nicht Kontrolle sein, sondern Integrität. Ich glaube, dass es der entscheidende Weg ist, die Werte des Vereins, seine Kultur stetig weiterzuentwickeln, um zu dieser Form der Integrität zu kommen.
Letzte Frage: Wann wird der WEISSE RING endlich überflüssig, weil er nicht mehr gebraucht wird?
Das ist die große Frage, ob man das Thema Kriminalität in einer Gesellschaft wirklich klären und lösen kann. Ich denke, das kann man nicht. Es wird immer Regelverletzungen geben. Irgendjemand hat mal gesagt: Jede Gesellschaft hat die Kriminalität, die sie verdient. Womöglich ist das so. Der WEISSE RING hat eine Daueraufgabe.
Karsten Krogmann und Nina Lenhardt





