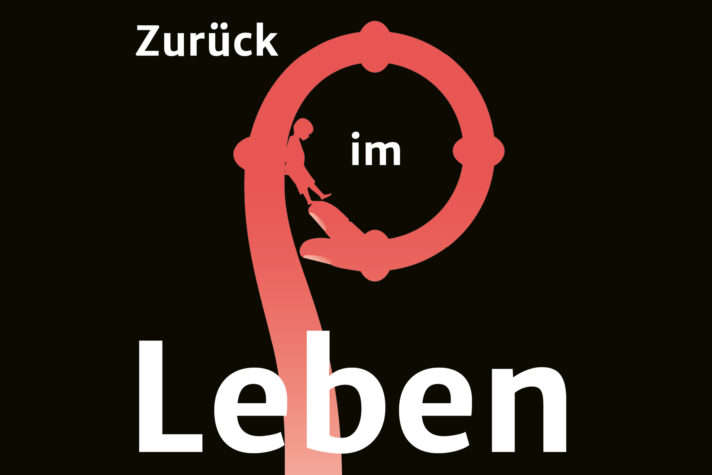Dr. Marius Riebel ist beim Wissenschaftspreis Opferschutz mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet worden (mehr zur Preisverleihung findet sich hier). Im Interview mit der Redaktion des WEISSEN RINGS spricht er darüber, welche Bedürfnisse Opfer im Strafverfahren haben, inwiefern diese berücksichtigt werden – und wo es dringenden Verbesserungsbedarf gibt.
Herr Dr. Riebel, Sie haben sich intensiv mit „Verletzteninteressen im Kontext des staatlichen Umgangs mit Straftaten“ befasst, einem Thema, dem sich die Rechtswissenschaft selten widmet. Wie sind Sie darauf gekommen?
Nach dem ersten Staatsexamen habe ich das Angebot angenommen, an der Universität Leipzig zu arbeiten, um mich tiefer mit rechtswissenschaftlichen Themen auseinandersetzen zu können. Daneben wollte ich etwas Praktisches machen, weshalb ich beim WEISSEN RING als ehrenamtlicher Berater angefangen habe. Oft wollten Betroffene über das anstehende bzw. vergangene Strafverfahren sprechen. Ihr Blick darauf war regelmäßig negativ und mit Ängsten verbunden. Das gab mir den Impuls, dazu zu forschen, welche Erwartungen Betroffene an den Staat und staatliche Verfahren haben.
Was haben Sie mit welchen Methoden untersucht?
Ich habe untersucht, welche Interessen Verletzte haben und inwieweit diese im Strafverfahren, aber auch in anderen staatlichen Verfahren berücksichtigt werden. Dazu habe ich bereits vorliegende empirische Untersuchungen, die Verletzteninteressen herausgearbeitet haben, ausgewertet und die Erkenntnisse mit der derzeitigen Ausgestaltung des Rechts abgeglichen. Dabei habe ich mich zum einen abstrakt mit der Legitimität von Verletztenbelangen auseinandergesetzt. Zum anderen habe ich die bestehenden Rechtsinstitute auf ihr Befriedigungspotenzial hin untersucht und Verbesserungsmöglichkeiten entwickelt.
Was haben Sie im Wesentlichen herausgefunden?
Häufig wird davon ausgegangen, dass Verletzte eine möglichst harte Bestrafung wollen. Die Strafe ist für sie tatsächlich ein relevanter Aspekt. Hier geht es aber weniger um eine möglichst harte Sanktion, sondern mehr darum, dass überhaupt eine staatliche Reaktion erfolgt. Damit wird auch eine Form von Anerkennung verbunden. Daneben haben Betroffene aber auch materielle und immaterielle Bedürfnisse: Zum einen sollen Kosten – bspw. für die medizinische Versorgung oder den Rechtsbeistand – kompensiert werden. Zum anderen wünschen Betroffene, dass während des Verfahrens auf sie eingegangen und Rücksicht auf ihre nicht selten bestehenden psychischen Belastungen genommen wird. Im Zuge dessen ist es relevant, dass sie informiert am Verfahren teilhaben und ihre Perspektive auch aktiv einbringen können. Ein solcher Umgang kann dazu beitragen, dass sie das erlittene Unrecht verarbeiten und damit langfristig leben können. Mit Blick auf den Strafprozess konnte ich feststellen, dass es bereits eine ganze Reihe von Instrumenten gibt, die eine verletztengerechte Behandlung sicherstellen können. Gleichzeitig werden diese in bestimmten Bereichen aber nicht genug angewendet. Außerdem konnte ich weitere Gestaltungsspielräume herausarbeiten.

Welche Instrumente können beispielsweise helfen, die Interessen von Verletzten zu berücksichtigen?
In Untersuchungen wird von Verletzten beispielsweise die Aussage vor Gericht, aber auch die Konfrontation mit dem Täter als besonders belastend beschrieben. Hier kann bereits heute Videotechnik eingesetzt werden, um derartige Situationen abzumildern und Mehrfachvernehmungen zu verhindern. Auch ein Ausschluss der Öffentlichkeit oder die Entfernung des Angeklagten kann helfen. Außerdem haben Verletzte Aktivrechte – wie beispielsweise die Möglichkeit sich als Nebenkläger anzuschließen. Darüber hinaus existieren Informationsrechte, wobei das Gesetz das Idealbild eines über seine Rechte voll informierten Verletzten verfolgt. Die Interessen Betroffener haben aber auch Grenzen, etwa Rechte der Verteidigung oder rechtsstaatliche Prinzipien wie „in dubio pro reo“. All diese Maximen sind richtig und wichtig, können aber dazu führen, dass ein Urteil oder auch eine Einstellungsentscheidung dem Verletzten keine Anerkennung bringt. Umso wichtiger ist es, das Verfahren so opfersensibel wie möglich zu gestalten. Hier besteht aus meiner Sicht ein großes Potenzial in der Kommunikation mit Verletzten. Wenn ein Täter beispielsweise „in dubio pro reo“ freigesprochen wird, sollte dem Verletzten diese Entscheidung umfassend erklärt werden – auch gerichtsseitig. Dies kann die von Verletztenseite gewünschte Anerkennung bringen, Rechtsfrieden schaffen und zudem Vertrauen in den Rechtsstaat stärken.
Mit welchen weiteren Mitteln könnte die Justiz den Bedürfnissen von Betroffenen besser Rechnung tragen?
Es gibt einige Stellschrauben. Um einige Details zu nennen: Im Bereich der Nebenklage könnten umfassendere Prozesskostenhilferegelungen geschaffen werden. Außerdem sollte der Kreis der Nebenklageberechtigten überarbeitet werden. Auch das Institut der psychosozialen Prozessbegleitung ist weiter optimierungsbedürftig. Ein großer Wurf könnte allerdings gelingen, indem die juristische Aus- und Fortbildung verbessert würde. Hier spielen Verletztenrechte und Disziplinen wie Viktimologie bisher kaum eine Rolle. Das muss sich ändern. Juristen sollten sich – zumindest, wenn sie später etwa mit häuslicher oder sexualisierter Gewalt zu tun haben – damit auseinandersetzen, was Straftaten und Verfahren mit Betroffenen machen. Ich plädiere dafür, Qualifikationsstandards zu normieren. Als Vorbild kann dabei das Jugendgerichtsgesetz dienen, wo es unter anderem heißt, dass Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein müssen. Paragraph 37 JGG fordert hier spezifische Kenntnisse in bestimmten Bereichen. Über eine vergleichbare Regelung für Beteiligte an für Verletzte besonders belastenden Strafverfahren sollte zumindest diskutiert werden. Abschließend ist es allerdings auch wichtig, den Blick auf andere Verfahren zu weiten. Hier birgt das soziale Entschädigungsrecht (SGB XIV) große Potenziale, die künftig noch weiter genutzt werden sollten.
Interview: Gregor Haschnik
Zur Person
Dr. Marius Riebel befindet sich seit Mai 2024 im Rechtsreferendariat des Freistaates Sachsen im Landgerichtsbezirk Leipzig. Neben seinem beruflichen Engagement ist er seit 2019 aktives Mitglied beim WEISSEN RING. Vor seinem Referendariat war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Leipzig, nach seinem mit Prädikat abgeschlossenen Studium der Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Kriminalwissenschaften. Für seine Arbeit zu „Verletzteninteressen im Kontext des staatlichen Umgangs mit Straftaten“ ist er beim Wissenschaftspreis des Bundeskriminalamtes und der WEISSEN RINGS mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet worden.