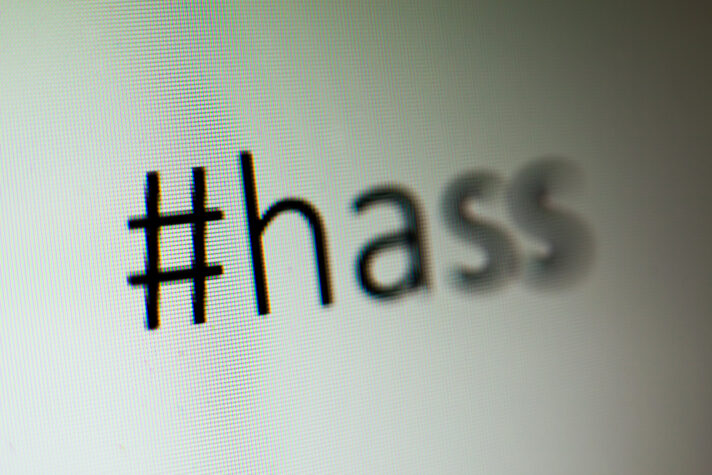Im Bundesverband VBRG e. V. haben sich die spezialisierten Beratungsstellen der fünf ostdeutschen Bundesländer sowie die von Berlin, Hamburg, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein zusammengeschlossen, um Betroffenen von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt niedrigschwellige Hilfe anzubieten und entsprechende Taten zu dokumentieren. Wer etwa aufgrund seiner Hautfarbe oder Religion angegriffen wird, findet in den professionellen Beratungsteams vielerorts Bezugspersonen, die juristischen oder psychologischen Beistand organisieren.
Der Verband geht bei rechten Delikten von einer hohen Dunkelziffer aus. Einerseits fehlt Opfern mitunter das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden, um Straftaten anzuzeigen, andererseits mangelt es in Behörden und bei Lehrkräften oftmals an Wissen um rassistische oder antisemitische Tatmotive. „Kinder und Jugendliche sind besonders vulnerabel und müssen daher auch besonders geschützt und unterstützt werden“, betonen Heike Kleffner und Robert Kusche für den VBRG.
Erschreckende Normalisierung
Die gestiegenen Fallzahlen seit 2015/16 zeigen ihnen zufolge eine erschreckende Normalisierung von rechten, antisemitischen und rassistischen Diskursen. Diese würden durch Debatten, in denen Geflüchtete als kriminell stigmatisiert und ihrer Menschlichkeit beraubt würden, vorangetrieben und maßgeblich über soziale Medien verbreitet. „Dadurch sinkt die Hemmschwelle sogenannter rassistischer Gelegenheitstäter:innen“, so Kleffner und Kusche. Die Radikalisierung eines Teils der Gesellschaft bekommen Heranwachsende also schmerzhaft zu spüren: „Kinder und Jugendliche of Color machen leider die Erfahrung, dass es für sie keine sicheren Orte gibt.“ Beleidigt und angegriffen werden Minderjährige demnach von Nachbarinnen und Nachbarn, auf dem Weg zur Schule, auf Spielplätzen, beim Sport und in der Schule.
„Angriffe finden ausschließlich in Alltagssituationen statt“, bestätigt Kati Becker, Leiterin des Berliner Registers, einer Melde- und Dokumentationsstelle für Fälle von Diskriminierung. Betroffen sind nach deren Erhebungen u.a. schwarze Kinder, Sinti und Roma, muslimische Kinder und solche aus der Ukraine. Erwachsene Männer, die Kinder auf Spielplätzen attackieren, seien häufig alkoholisiert, berichtet Becker. Das einzig erkennbare Muster bei Täterinnen und Tätern sei „eine rassistische Ideologie“. Rassistische Mobilisierungen führten „ganz klar zu einem Anstieg rassistischer Gewalt“. Die Bestätigung flüchtlingsfeindlicher Aussagen aus den Reihen der demokratischen Volksparteien legitimierten Gewalttaten, warnt Becker. Nach ihren Erfahrungen dauert es üblicherweise sechs Monate, bis rassistische Debatten, die in der Öffentlichkeit geführt werden, in Gewalt umschlagen.
„Erleben allzu oft eine Täter-Opfer-Umkehr“
Die Verfolgung dieser menschenfeindlichen Delikte wird in der Praxis nicht nur durch Unwissenheit, sondern auch durch weit verbreitete Vorurteile erschwert. „Leider erleben wir allzu oft eine rassistische Täter-Opfer-Umkehr durch Polizei und Justiz“, kritisiert das VBRG-Duo. Nach den Erfahrungen der Opferberatungen werden nicht selten junge Menschen, die Herabwürdigungen und körperliche Gewalt erfahren, bei Ermittlungen als das eigentliche Problem betrachtet oder als „Nestbeschmutzer“ oder Provokateure angefeindet, weil sie Missstände sichtbar machen. Abhilfe könnten Rassismus-Beauftragte bei Polizei und Justiz schaffen, um eine größere Sensibilisierung innerhalb der Sicherheitsbehörden zu erreichen. Auch gibt es bundesweit noch nicht überall flächendeckend spezialisierte Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften, die Erfahrung mit ideologischen Tatmotiven haben. Rassismus kann nach einer Reform des Paragraphen 46 StGB vor Gericht strafverschärfend gewertet werden – vorausgesetzt, er wird von Staatsanwaltschaften überhaupt ermittelt und festgestellt. Neben juristischem Personal sollten nach Überzeugung vieler Expertinnen und Experten auch Lehrkräfte umfassend geschult werden, um das vermutete Dunkelfeld bei rassistischen Gewalttaten zu erhellen.
„Kinder und Jugendliche extrem unter Druck“
Denn die Folgen für Kinder und Jugendliche, die attackiert werden, sind gravierend. Jede und jeder reagiert anders darauf. Aber die Opferberatungen beobachten durchaus erhebliche Auswirkungen wie den Abfall schulischer Leistungen, Entwicklungsstörungen und Posttraumatische Belastungsstörungen. Einige entwickeln Symptome wie Schlafstörungen oder Panikattacken. Gerade in ländlichen Regionen und da, wo es keine geschulten Opferberatungen gibt, ist der Weg zu professioneller Hilfe weit und kompliziert. Umso wichtiger ist es, pädagogisches Personal in Kitas und Schulen für das Thema zu sensibilisieren und weiterzubilden. Heike Kleffner und Robert Kusche weisen für den VBRG darauf hin, dass zu den Erfahrungen mit rassistischer Diskriminierung und Gewalt bei vielen Betroffenen noch Ängste um den Aufenthaltsstatus der eigenen Familien kommen. „Kinder und Jugendliche stehen mitunter extrem unter Druck“, sagen die beiden. Ein Zustand permanenter Angst und Unsicherheit verhindert bei zu vielen eine unbeschwerte Kindheit und Jugend.
Seit Jahren fordern Opferberatungen ein Bleiberecht für Betroffene rassistischer und antisemitischer Gewalt. Dafür müsste der Paragraph 25 des Aufenthaltsgesetzes geändert werden. Als klares Bekenntnis des Staates, die Opfer zu schützen – und als Signal an die Täter, dass sie mit menschenverachtender Ideologie und Brutalität keinen Erfolg haben.
Michael Kraske