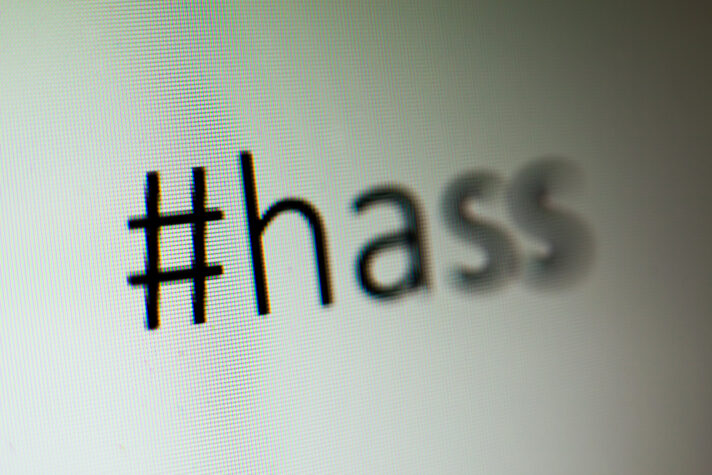Frau Claus, Sie sind die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, kurz UBSKM. Wie erklären Sie jemanden, der zum ersten Mal über die sperrige Abkürzung stolpert, was sich dahinter verbirgt?
Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gab es in der Vergangenheit, gibt es heute – und wird es trotz meines Amtes auch morgen noch geben. Unser aller Ziel muss aber sein, Kinder künftig besser zu schützen oder mindestens frühzeitig die Gewalt aufzudecken und zu beenden. Damit das gelingt, braucht es das Engagement von ganz vielen. Dazu gehört die Politik, weil sie Schutz und Hilfen ermöglichen muss. Dazu gehört aber auch die Gesellschaft. Denn jede und jeder von uns kann dazu beitragen, Kinder besser zu schützen. Und dann geht es auch um die vielen Betroffenen, die heute erwachsen sind. Auch sie haben ein Recht auf bedarfsgerechte Hilfe, ein Recht, heute gesehen und gehört zu werden. Wenn wir im Rahmen von Prävention Hilfe, Schutz und Beratung verbessern wollen, ist das Erfahrungswissen Betroffener immer wieder ein Schlüssel zum Verständnis auch und gerade im Blick auf Täterstrategien. All das beschreibt ganz gut, worum es in meinem politischen Amt geht. Das UBSKM-Amt bin ich natürlich nicht allein, dafür arbeiten hier fast 30 Kolleginnen und Kollegen mit vielfältigster fachlicher Expertise.
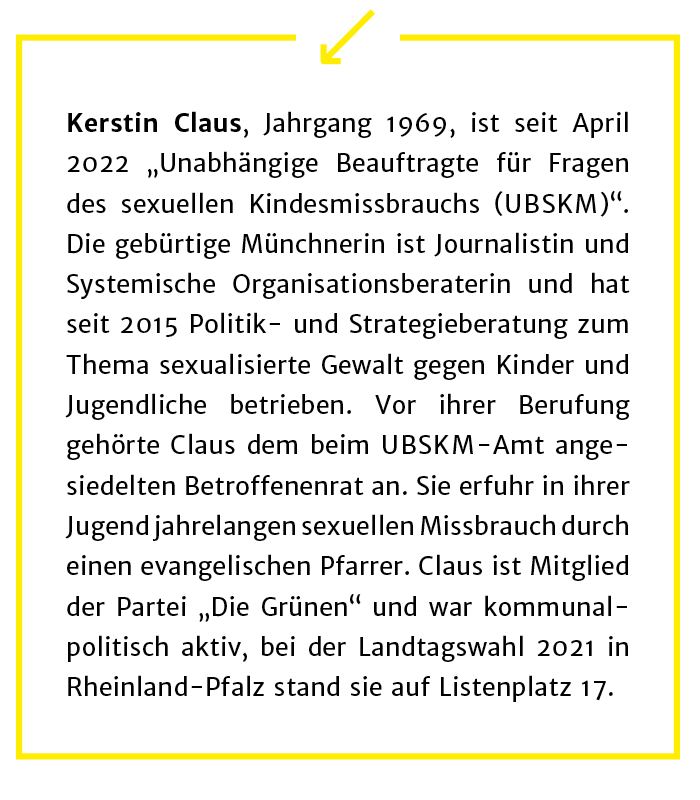
Würden Sie sagen, dass es Ihre wichtigste Aufgabe ist, die Betroffenen und ihr Leid sichtbarer zu machen in der Gesellschaft?
Ich sehe es als Herausforderung, das Thema sexueller Missbrauch an Menschen heranzutragen, ohne dass sie sagen: „Oh je, schon wieder, damit habe ich nichts zu tun.“ Ich will dieses Tabu aufbrechen, damit wir alle in diesem Themenfeld handlungsfähiger werden.
Was meinen Sie mit „Tabu“?
Wir haben letztes Jahr eine Befragung zu sexualisierter Gewalt gemacht: Über 90 Prozent der Befragten bejahten die Aussage: „Sexualisierte Gewalt passiert überall an Kindern und Jugendlichen, vor allem in der Familie.“ Auf die anschließende Frage, ob diese Taten auch in ihrer Nähe stattfinden, lautete die Antwort: „Nee, nee, nicht hier.“
Woran liegt das?
Wir müssen wissen, wie Täterstrategien funktionieren, damit unsere Gesellschaft nicht blind bleibt. Wir Erwachsenen ziehen viel zu schnell den Schulterschluss zu anderen Erwachsenen und sagen: „Moment, wenn mir jemand eine Täterschaft vorwerfen würde, das wäre ja mein Ende, etwa im Job oder als Trainer im Sportverein. Mit so einem Vorwurf würde ich auch nicht konfrontiert werden wollen.“ Aber jede und jeder von uns sollte den Gedanken zulassen, dass auch Kinder in unserer nächsten Umgebung — in unserer eigenen Familie, in unserer Nachbarschaft — potenziell einer solchen Gefahr ausgesetzt sind und viele von ihnen diese ganz real erleben müssen. Wir müssen auch den Gedanken zulassen, dass jede und jeder von uns mit großer Wahrscheinlichkeit auch Täter und Täterinnen kennt. Erst wenn wir das begreifen, werden wir tatsächlich in die Verantwortung gehen und Partei für betroffene Kinder und Jugendliche ergreifen, ob als Eltern, Nachbarn, Lehrkräfte oder Politik. Ich sehe es als meine wesentliche Aufgabe, hier wachzurütteln.
Wie machen Sie das: wachrütteln?
Einmal ganz konkret über Interviews, in öffentlichen Vorträgen und Diskussionen. Wie alle müssen verstehen, worum es geht und dass wir individuell und als Gesellschaft in der Verantwortung stehen. Und dann natürlich politisch-fachlich: Wir sind eingebunden in Gesetzgebungsverfahren, befassen uns sowohl mit Prävention als auch mit Hilfen, Forschung, der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Wir entwickeln Kooperationen wie „Schule gegen sexualisierte Gewalt“, um in allen Bundesländern Schutzkonzepte in Schulen zu verankern. Wir vernetzen und ermöglichen Expertise gemeinsam mit dem Betroffenenrat und der Aufarbeitungskommission. Konkrete Strategien und Handlungsleitfäden beispielsweise zu kindgerechter Justiz werden im Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen entwickelt, dem Bundesfamilienministerin Paus und ich gemeinsam vorsitzen. Und vieles ist schlicht politischer Austausch und Vernetzung: Hier geht es beispielsweise um den Austausch mit der Kinderkommission und dem Familienausschuss, aber auch allen interessierten Ministerinnen und Ministern und Abgeordneten, im Bund, aber auch in den Ländern.
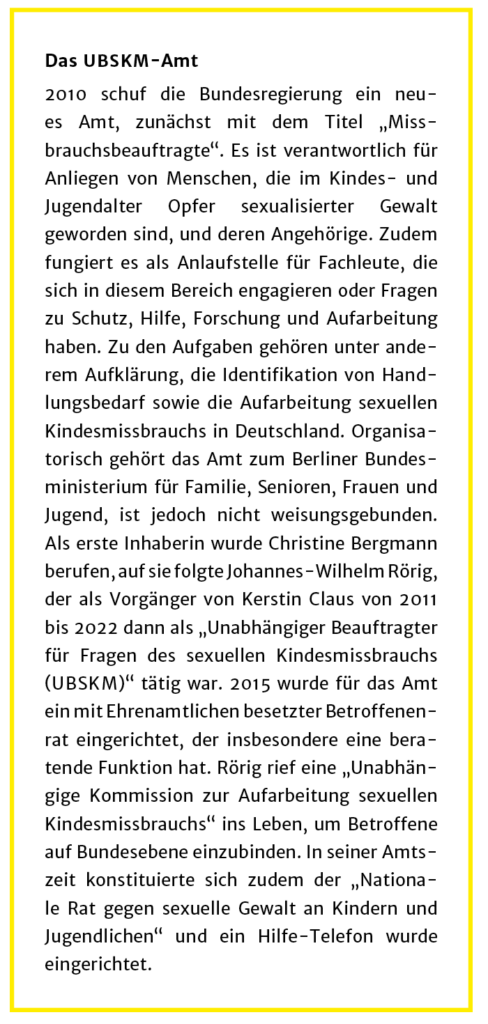
Was erwarten Sie von der Politik? Auf welcher Ebene muss sie sich mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche befassen?
Ich möchte die politische Verantwortungsübernahme auf Bundes- und auf Landesebene. Als jemand, die selbst kommunalpolitische Erfahrung mitbringt, weiß ich aber sehr wohl, dass es am Ende die kommunale Verantwortung braucht, Bürgerinnen und Bürger, Eltern, Fachkräfte. Kommunale Netzwerke können dazu beitragen, dass zum Beispiel Vereine Wege finden, Schutzkonzepte zu entwickeln. Dass in einer Gemeinde oder einem Landkreis Schutzprogramme entstehen für alle Bereiche, in denen sich Kinder und Jugendliche bewegen. Es reicht bei der Prävention nicht, wenn es nur heißt: „Wir machen Kinder stark“ oder „Mein Körper gehört mir“, so wichtig diese Bausteine auch sind. Mein Ziel ist es, bundesweit immer wieder vor Ort zu sein, nicht nur mit Landespolitik, sondern auch mit Kommunalpolitik und dortige Initiativen einzubeziehen, um Räume zu öffnen und zu zeigen: Wir alle können was verändern und damit Gefahren abwehren, denen Kinder ausgesetzt sind.
Wie rütteln Sie Menschen außerhalb der Politik wach?
Wir müssen Orientierung und Handlungskompetenz in die Fläche bringen. Solange ich hilflos bin, versuche ich zu vermeiden, etwas zu tun. Das erleben wir bei Autounfällen: Liegt der Erste-Hilfe-Kurs schon ewig zurück, ist man froh, wenn es jemanden anderen gibt, der bei einem Unfall beherzt erste Hilfe leistet. Deswegen sage ich, nicht alle müssen Fachleute im Kinderschutz sein, aber wer ein komisches Bauchgefühl hat, weil ihm oder ihr etwas seltsam vorkommt, muss wissen, wo es Hilfe und Unterstützung gibt – zum Beispiel beim bundesweiten Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch, aber auch bei Fachberatungsstellen vor Ort, die erst einmal Orientierung geben, beraten und unterstützen können. Man muss also nicht sofort vor der Frage stehen, ob man jetzt zur Polizei oder zum Jugendamt muss. Es geht um gute erste Schritte, die Möglichkeit, aktiv zu werden – und hierfür die Hürden zu senken.
Sie sagten, dass noch immer 90 Prozent der Menschen meinen, in ihrem eigenen Umfeld gebe es keinen Missbrauch von Minderjährigen – hat das Amt der UBSKM bisher zu wenig erreicht?
Allein meine Berufung zeigt, dass viel erreicht worden ist. Noch vor einigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass jemand mit eigener Betroffenheit dieses Amt übernimmt. Auch medial wäre das ganz anders aufgenommen worden als heute, denn Opfer-Stigmatisierung greift gerade im Kontext sexualisierter Gewalt schnell. Meine Fachlichkeit wurde nie in Frage gestellt, ich durfte von Anfang an beides sein: kompetent und betroffen. Dies ist gelungen über die vielfältige Arbeit meiner beiden Vorgänger im Amt, auch weil sie Strukturen geschaffen haben, die für unsere Arbeit wichtig sind – etwa den Betroffenenrat, die Aufarbeitungskommission, den Nationalen Rat. Vieles was erreicht wurde, hat hier seinen Ausgangspunkt, daran knüpfe ich an.
Das U in UBSKM steht für unabhängig, Sie sind selbst Betroffene. Wie unabhängig können Sie da sein?
Ich habe sicher eine Parteilichkeit: Ich bin parteilich für die Belange von Betroffenen, und ich verstehe mich als jemand, die noch mal anders aufzeigen kann, warum etwas notwendig ist. Unabhängig bin ich, weil ich den Finger in die Wunde legen und Initiative ergreifen darf und mir niemand vorschreiben darf, wie ich das tue. Und natürlich haben Betroffene eine sehr spezifische Fachlichkeit: Sie haben erlebt, wie Täterstrategien funktionieren. Sie haben Wissen, was damals geholfen hätte, wie es hätte verhindert werden können, was heute gebraucht wird. Eine solche Expertise in fachliche Diskurse und in Fragen der Weiterbildung einzubringen, ist ein Plus und schadet der Unabhängigkeit in keiner Weise.
Wurde Ihnen die Parteilichkeit schon einmal zum Vorwurf gemacht?
Ich habe meinen Vorgänger Johannes-Wilhelm Rörig als sehr parteilich empfunden, und ich glaube, ohne diese Parteilichkeit hätte er weder den Betroffenenrat noch die Aufarbeitungskommission politisch durchsetzen können. Diese Parteilichkeit ist Teil des Amtes, und ich erlebe sie immer eher als Türöffner. Weil ich nicht an die Politik herantrete und sage: „Ihr wisst doch schon alles, jetzt macht endlich“, sondern weil ich erklären kann, warum etwas ein wichtiges politisches Ziel ist.
Was hören Sie von anderen Betroffenen, seitdem Sie das Amt übernommen haben?
Sie haben mehr Erwartungen und einen höheren Anspruch an mich. Ich merke, dass ich in einer Rechenschaftspflicht bin. Ich habe weder meine Telefonnummer geändert, noch bin ich sonst irgendwie abgetaucht, und daher stehe ich im Austausch mit anderen. Aber es gibt auch Social Media, und ich brauche nur bei Twitter mitzulesen, um zu sehen, dass Erwartungen an mich anders formuliert werden, als sie es bezogen auf meinen Vorgänger waren.
Was lesen Sie da heraus — mehr Ungeduld?
Es ist eine Mischung. Teilweise bekomme ich viel Rückendeckung, mit dem Tenor: gut, dass da jemand „von uns“ ist (lacht). Ungeduld lese ich auch heraus. Neulich habe mich mal bei Twitter eingeschaltet und versucht zu erläutern, dass UBSKM ein politisches Amt ist und dass es politische Prozesse sind, in denen es vor allem um Gesetze und fachliche Diskurse geht. Zum Beispiel um zu schauen, wie in der Ausbildung für pädagogische oder medizinische Berufe Grundkenntnisse zu sexualisierter Gewalt verankert werden können. Das geht erstens nicht schnell. Zweitens muss ich immer wieder mal erklären, dass ich nicht die Fürsprecherin von individuellen Belangen sein kann oder die persönliche Ansprechstelle für Betroffene. Trotzdem hilft es mir, auch mit Betroffenen vernetzt zu sein. Das, was ich da sehe und lerne, vervollständigt das Bild, mit dem ich auch in politische Verhandlungen gehe oder aber in Gespräche, beispielsweise mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, mit der katholischen oder evangelischen Kirche oder der Jugendhilfe.
„Unabhängig und nicht weisungsgebunden“ steht in der Amtsbeschreibung der UBSKM. Sie sind an ein Ministerium angebunden, wir sitzen hier in Ministeriumsräumen. Sie sind Mitglied der Grünen. Wie unabhängig können Sie politisch sein?
Ich bin zwar organisatorisch angedockt an das Familienministerium, und das macht an vielen Stellen natürlich auch Sinn. Aber eine Ministerin kann nicht bei mir anrufen und sagen: „Ich möchte, dass Sie die Position unterstützen, die wir hier vertreten.“ Natürlich kann und werde ich, wenn es notwendig ist, Entscheidungen des Ministeriums oder der Bundesregierung kritisieren – oder sie eben unterstützen, wenn ich das fachlich für richtig halte. Das Thema sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige braucht alle demokratischen Parteien, wenn wir etwas verändern wollen. Deswegen spreche ich selbstverständlich auch mit allen – überparteilich und ressortübergreifend.

Für Betroffene von sexuellem Missbrauch ist staatliche Opferentschädigung ein großes Thema, das entsprechende Gesetz wurde novelliert und tritt 2024 in Kraft. Ist 2024 endlich alles gut?
Das ist ein absolut wichtiges Thema, bei dem ich weiterhin Forderungen aufstellen werde. Das Gesetz ist zwar reformiert, das heißt aber nicht automatisch, dass alles besser wird und man nichts mehr anfassen muss. Ich bin der festen Meinung, dass die Neuerungen konsequent evaluiert werden müssen. Auch gibt es bisher gibt es keine Feedbackschleifen, in denen Betroffene im Verfahren gefragt werden: „Wie können Verfahren verbessert werden oder war die Beratung durch das Versorgungsamt hilfreich?“ Die quantitative und qualitative Evaluation ist aus meiner Sicht bei der Reform nicht ausreichend berücksichtigt worden. Für Betroffene sind das aber ganz wesentliche Fragen. Hier sehe ich die Länder in der Pflicht, zu erfassen und auszuwerten, was in ihren Behörden passiert.
Haben Sie als Betroffene persönlich Erfahrungen mit dem Verfahren nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) gemacht?
Ja, ich habe einen OEG-Antrag gestellt und in der Folge auch spezifische Leistungen beantragt. Ich kann mich aufgrund meines journalistischen Hintergrunds ziemlich in Themen verbeißen und habe mir so schrittweise eine recht hohe Kompetenz rund um das OEG angeeignet. Das hat nicht unbedingt für mein eigenes Verfahren geholfen — aber dabei, eine klare und vielleicht auch in Teilen wichtige Stimme in diesem Reformprozess zu sein.
Betroffene kritisieren nicht so sehr das Gesetz, sondern vor allem dessen Umsetzung durch die Behörden: langwierige Verfahren, belastende Befragungen und Begutachtungen, zu viele Ablehnungen. Was müsste sich tun, damit das Gesetz dieser Kritik in der Umsetzung gerecht wird?
Betroffene berichten immer wieder, dass sie sich nach ihrem Antrag beispielsweise auch einer Glaubhaftigkeitsbegutachtung aussetzen mussten, dabei hat die im Opferentschädigungsrecht nichts zu suchen. Zum anderen ist die Anerkennung ja nur ein erster Schritt. Um konkrete Leistungen geht es erst nach der Anerkennung als Opfer einer Gewalttat und der mit der Tat einhergehenden Schädigungsfolgen. Wenn es dann darum geht, welche Hilfen gibt es konkret, beispielsweise um einen Schulabschluss oder eine Ausbildung nachzuholen, die aufgrund der häufig jahrelangen sexuellen Gewalt damals nicht möglich war, beginnt oft immer wieder eine neue Mühle im Verfahren. Viele Betroffene geben da irgendwann auf.
Welche Rolle spielt dabei die Verfahrensdauer?
Die langen Zeitabläufe in den Verwaltungsbehörden können sehr belastend sein. Das war auch für mich immer wieder so. Ich weiß von sehr vielen Betroffenen, die schon ganz früh gescheitert sind, denen es nach der Antragstellung schrittweise immer schlechter ging, weil sie auf Hilfe hofften und stattdessen einem unkalkulierbaren und oft nicht verständlichen Verfahren ausgesetzt waren. Genau hier liegt meine Motivation. Es braucht endlich betroffenenzentrierte Verfahren, das sage ich als Unabhängige Beauftragte und auch als Kerstin Claus, die diese Verfahren selbst durchlaufen hat.
Wie sähe ein solches betroffenenzentriertes Verfahren aus?
Menschen in Versorgungsverwaltungen brauchen ein Grundverständnis zu komplexen Traumatisierungen aufgrund sexualisierter Gewalt. Das heißt, sie benötigen eine Qualifikation im Umgang mit Menschen, die massive sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend erlebt haben. Sie müssen Betroffene einbeziehen, ernstnehmen und Teil des eigenen Hilfeplanverfahrens werden lassen, so dass gemeinsam auf Augenhöhe der Bedarf festgestellt wird. Ideal wäre, wenn es jemanden als Ansprechpartner im Verfahren gäbe, der oder die alles weitere steuert. Betroffene als Kunden zu sehen, dafür braucht es in den Behörden eine spezifische Haltung, die letztlich gelernt werden muss. Das hat auch etwas mit Qualifizierung und Fortbildung zu tun.
Exklusiv: Der #OEGreport – Alle Recherchen im Überblick
Betroffene beklagen immer wieder, dass sie zu wenig über die Verfahrensschritte erfahren, nicht wissen, was passiert, wo gerade nachgefragt wird, in welchem Zeitrahmen sie eine Antwort erwarten können. Ohne externe Hilfe, etwa durch die wenigen spezialisierten Anwälte und Anwältinnen, fehlen oftmals Erklärungen und Transparenz. Fachberatungsstellen, die viele Berichte von gescheiterten Verfahren hören, raten deswegen oft von einer Antragstellung ab. Verständlich, aber ich finde das total frustrierend, weil das Opferentschädigungsrecht eigentlich sehr viel bietet, wenn es nach solchen massiven Gewalterfahrungen in Kindheit oder Jugend darum geht, gute eigene Wege zu finden.
Ab 2024 soll es laut Gesetz in jedem Bundesland Fallmanagerinnen und -manager geben, die für die Behörden arbeiten. Wird damit alles besser?
Eine Frage ist, ob Fallmanager deutschlandweit gleich qualifiziert werden. Es kann ja nicht vom Glück abhängen, in welchem Bundesland ein Antrag bearbeitet wird. Eine Lösung für die Entwicklung und Implementierung für Qualifizierungsstandards in allen Bundesländern wäre E-Learning. Zu diesem Thema bin ich bereits in Gesprächen mit dem Sozialministerium. Im Nationalen Rat haben wir uns zudem Handlungsleitfäden für die Abwicklung von OEG-Verfahren auf unseren Arbeitszettel geschrieben, über die eine solche Vergleichbarkeit auch erreicht werden kann. Das von Ihnen angesprochene Fallmanagement ist, und das muss man sich klar machen, geplant als Teil der Versorgungsverwaltung — und darin sehe ich ein Problem.
#OEGreport: Interview mit einem Sonderbetreuer
Vielleicht sollte das Fallmanagement bewusst extern aufgestellt sein, beispielsweise in Kombination mit Kooperationsverträgen, die zusätzlich externe, unabhängige Fachberatungsstellen einbezieht. Hessen etwa hat hier gerade spannende Ansätze entwickelt, im Rahmen der Aktualisierung des Landesaktionsplans. Ich bin überzeugt, dass massiv Kosten und Verwaltungsressourcen eingespart werden könnten, wenn über solche Wege die Verfahren fokussierter auf die Belange Betroffener und vor allem auch zügiger gestaltet werden. Damit will ich nicht dem Ausgang von Verfahren vorgreifen: Aber zügig Klarheit über Möglichkeiten und Grenzen im Rahmen von OEG-Verfahren zu haben, hilft am Ende allen, insbesondere den Betroffenen. So können zusätzliche Verletzungen und Retraumatisierungen verhindert werden.
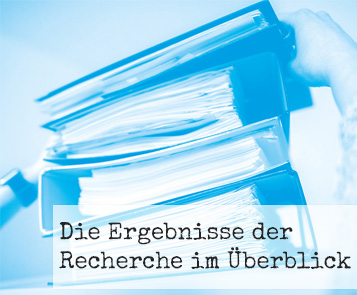
Ist es ein Hemmnis, dass das OEG ein Bundesgesetz ist, für die Umsetzung aber die Länder verantwortlich sind?
Dem Bund sind ein Stück weit die Hände gebunden, etwa was Ausbildung und Qualifizierung von Mitarbeitenden in Landesbehörden angeht. Es wird beständig Prozesse brauchen, in die auch Betroffene mit ihrer Expertise eingebunden werden müssen. Auch dies ist ein Grund, warum ich Betroffenenräte auf Landesebene fordere, damit eine solche politisch beratende Struktur politische Entscheidungen fundiert begleiten kann. Das hat sich seit Jahren im Bund bewährt. Und ich wünsche mir bei der Opferentschädigung einen Wettstreit der Bundesländer. Es wird Bundesländer geben, die vorangehen und die betroffenenzentrierter arbeiten, die Kooperationsverträge zur externen Begleitung Betroffener schließen — und dann wird es mein Job sein, den anderen Ländern zu sagen: „Hey, wenn die das können, könnt ihr das doch auch!“
Das UBSKM-Amt gibt es seit zwölf Jahren. Sind Missbrauchsopfer in der Gesellschaft sichtbarer geworden?
Ja und nein. Das Aufdecken bestimmter Strukturen — ausgelöst durch Fälle wie Lüdge, Bergisch Gladbach, Münster oder Wermelskirchen— hat geholfen, einen Scheinwerfer auf Gewalt zu richten, die es vorher schon gab. Und von der Betroffene auch berichtet haben, denen vielfach aber nicht geglaubt wurde. Auch Bild- und Tonaufnahmen gab es früher schon, aber das Internet macht jetzt sichtbar, was im monströsen Sinne möglich ist. Ja, wir sind weitergekommen, und wir sprechen auch nicht mehr nur von lauter Einzelfällen, sondern endlich auch von strukturellen Problemen, die Missbrauch begünstigen. Leider geht das in der Berichterstattung aber viel zu häufig einher mit einer Reduktion auf vermeintlich krankhafte Störungen. Selbst öffentlich-rechtliche Medien sprechen dann von den sogenannten pädophilen Tätern. Das ist einerseits zutiefst ungerecht gegenüber Menschen mit sexuellen Präferenzstörungen, die nie Täter oder Täterin werden. Wenn wir diese Taten nur in die Krankheitsecke schieben, verkennen wir, dass Täter und Täterinnen vor allem Macht- und Abhängigkeitsstrukturen ausnutzen. Dass sie also massiv manipulative Strategien anwenden, die immer wieder nicht erkannt werden, selbst in Strafprozessen nicht. Auch wir als Gesellschaft entlasten uns über diese Sichtweise immer wieder ein Stück weit, weil wir davon ausgehen, krankhafte Täter könne man erkennen – und deswegen den Gedanken nicht zulassen, dass sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche eine verstörende Realität inmitten unseres vermeintlich unauffälligen Umfeldes ist. Wenn wir aber etwas verändern wollen, Taten verhindern wollen, müssen wir uns klarmachen, dass diese Taten überall in unserer Umgebung passieren können und passieren.
Wenn in den Medien von sexuellem Missbrauch die Rede war, schien es seit Bekanntwerden der Vorgänge am Canisius-Kolleg 2010 häufig, als sei Missbrauch vor allem ein Problem der katholischen Kirche. Hat diese Berichterstattung möglicherweise den Blick verstellt auf die vielen anderen gesellschaftlichen Bereiche, in denen es ebenfalls zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche kam und kommt?
Natürlich hat sich mit 2010 die Wahrnehmung sexualisierter Gewalt in der Gesellschaft verändert, auch wenn der Ausgangspunkt Kirche und elitäre Schulstrukturen waren. Für die öffentliche Wahrnehmung des Themas war auch ausschlaggebend, dass erstmals erwachsene Männer gesprochen haben, die oftmals aus gut situierten Familien kamen und oft auch beruflich erfolgreich waren. Damit gelang ihnen, was den vielen Frauen, die schon seit Jahrzehnten vor allem auf sexuellen Missbrauch im familiären Kontext hingewiesen hatten, verwehrt geblieben war: Das Thema gelangte in den medialen und gesellschaftlichen Fokus. Allerdings ging damit einher, dass bis heute der Fokus auf institutionellen Strukturen – also sexueller Missbrauch im Kontext von Sport, der Schule oder der Kirchen – liegt. Staat und Kirche stehen seit diesem sogenannten Missbrauchsskandal von 2010 in einem neuen Spannungsfeld, weil plötzlich der Staat – und in diesem Prozess sind wir aktuell – sein Wächteramt auch im Verhältnis zur Kirche neu definieren muss. Das sind lange Debatten und Lernprozesse, gerade wenn es um die staatliche Verantwortung im Kontext von Aufarbeitung geht, und es ist eine sehr grundlegende Frage, die alle Betroffenen von sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend einschließen muss, also gerade auch die Betroffenen im Kontext Familie.
Wann werden wir so viel gelernt haben, dass die Aufgabe der UBSKM erledigt ist?
Solange sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ausgeübt wird, wird dieses Amt gebraucht werden. Aktuell arbeiten wir an der gesetzlichen Verankerung der Aufgaben dieses Amtes. Nach meinem Verständnis ist diese Gewaltform tief gesellschaftlich verwurzelt. Nicht nur allein in Institutionen wie Kirche oder Sportverein, sondern auch und gerade im sozialen Nahfeld, besonders im familiären Kontext. Wird es möglich sein, diese Gewalt zu überwinden? Ich setze zumindest all meine Kraft ein, damit Kinder und Jugendliche besser geschützt, diese Gewalt besser verstanden und schneller gehandelt wird und Betroffene konsequent bedarfsgerecht unterstützt werden. Nur so können wir die individuellen Folgen und die traumatischen Belastungen für Betroffene reduzieren. Betroffene brauchen ein Recht auf Aufarbeitung jenseits von Gerichtssälen. Es geht um ein Recht auf Sichtbarkeit heute, denn es ist auch eine Generationenaufgabe: Die einen Betroffenen sind jetzt vielleicht in ihren Zwanzigern, die anderen mittlerweile über 70 Jahre alt. Es ist notwendig, sich diese Dimension bewusst zu machen, weil die Folgen sexualisierter Gewalt gerade nicht enden, wenn die Taten aufhören, sondern eine ganze Lebensspanne umfassen. Erst dann anerkennen wir die tatsächliche Dimension sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige in unserer Gesellschaft.
Nina Lenhardt und Karsten Krogmann