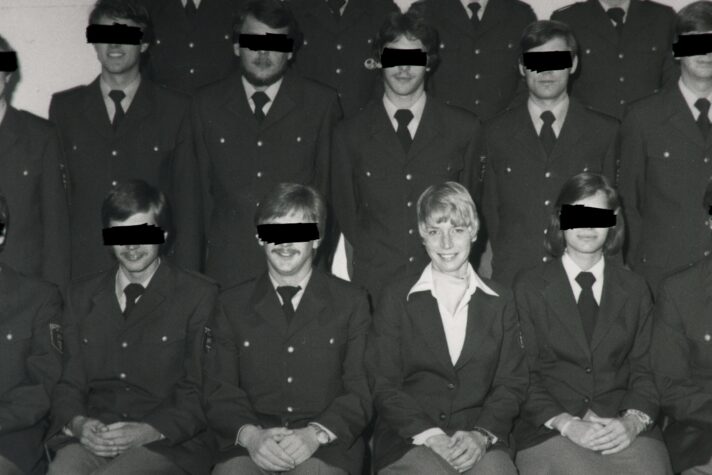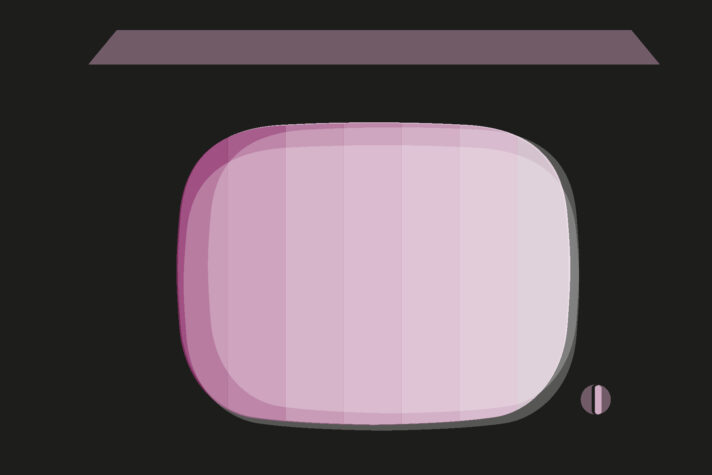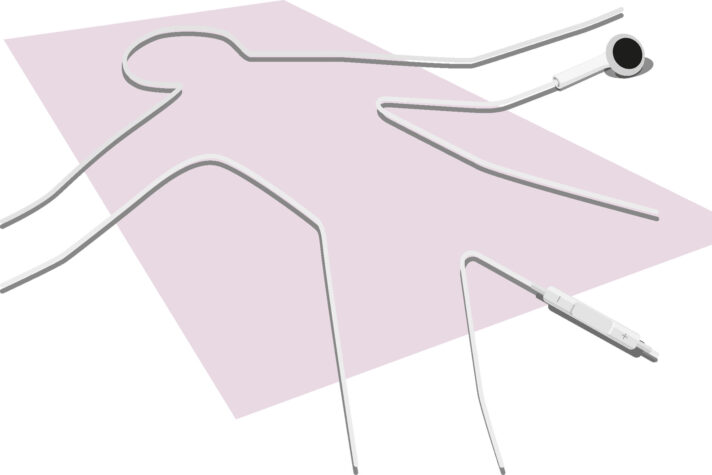Nahezu täglich erreichen den WEISSEN RING Anfragen von Journalisten aus ganz Deutschland, die Kontakt zu Kriminalitätsopfern suchen. Sie möchten Betroffene interviewen für Zeitungen, Fernsehsendungen oder Podcasts.
Auch zwei Dokumentarfilmerinnen aus München, die im Oktober 2021 eine E-Mail an den WEISSEN RING schickten, suchten Kontakt zu Opfern. Und doch war ihre Anfrage anders: Katharina Köster und Katrin Nemec wollten niemanden vor ihre Kamera stellen, sie wollten niemanden befragen – sie wollten die Opfer nur informieren. Über den Film, den sie zurzeit drehen.
„Wir wollten einfach nicht, dass die Betroffenen über den Flurfunk von unserem Projekt erfahren und aus Mangel an Informationen verunsichert werden. Wir wollten nicht neues Leid verursachen“, sagt Katharina Köster.
Kann man sein Kind noch lieben, wenn es zum Mörder wurde?
Das Projekt, das ist ein Dokumentarfilm über die Eltern des Serienmörders Niels Högel, der in den Jahren 2000 bis 2005 in Krankenhäusern in Norddeutschland mutmaßlich weit mehr als 100 Patientinnen und Patienten tötete. Vier Mal stand er vor Gericht, in insgesamt 91 Fällen wurde er verurteilt. „Wir teilen das Interesse an Themen, die uns an den Rand unserer Vorstellungskraft bringen, wo Richtig und Falsch nicht auf den ersten Blick erkennbar sind“, sagt Katrin Nemec über sich und ihre Kollegin Köster. So seien sie, selbst Mütter, zu der Frage gekommen: Kann man sein Kind noch lieben, wenn es zum Mörder wurde?
Lesen Sie auch: Niedersachsen will Selbstdarstellung von Tätern erschweren
In ihrem Film geht es ausschließlich um die Perspektive der Eltern des Mörders. Nicht um die des Mörders selbst („wenn wir sie bei einem Besuch im Gefängnis begleiten, machen wir die Kamera aus, bevor er den Raum betritt“), auch nicht um die seiner Opfer und ihrer Angehörigen. Gleichgültig sind den Filmemacherinnen die Angehörigen aber nicht. „In diesem Fall gibt es so viele Betroffene – das kann man nicht außer Acht lassen“, sagt Köster. „Und es gab schon sehr viel Berichterstattung zum Fall, und immer wieder wurde auch der schlechte Umgang der Medien mit den Familien der Opfer kritisiert“, so Nemec. Die Filmemacherinnen möchten es besser machen: Sie wollen, dass Betroffene frühzeitig informiert sind, sie wollen bei Bedarf deren Fragen beantworten, sie wollen bei Interesse sogar ein Vorab-Screening im geschützten Rahmen mit psychologischer Begleitung organisieren.
Sie wollen Kontakt zu Betroffenen herstellen
Zu sehen sein wird der Film frühestens im Jahr 2024 auf Festivals und 2025 in der ZDF-Reihe „Das kleine Fernsehspiel“. Die Dreharbeiten aber laufen bereits, der „Flurfunk“ dazu könnte Betroffene schon jetzt erreichen. „So eine Info kann ja immer auch Retraumatisierung hervorrufen“, befürchtet Köster. Deshalb schrieben die Filmemacherinnen an den WEISSEN RING, deshalb meldeten sie sich bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Seit eineinhalb Jahren bemühen sie sich nun neben ihrer Arbeit am Film, Kontakt zu Betroffenen herzustellen.
Helfen konnten ihnen dabei letztlich weder die Behörden noch der WEISSE RING – der Datenschutz steht dem entgegen. Allerdings hat der WEISSE RING in diesem besonderen Fall mit seinen vielen Betroffenen einen Brief an die Familien verschickt, die sich im Lauf der Jahre mit der Bitte um Unterstützung beim Verein gemeldet hatten. Petra Klein, stellvertretende Bundesvorsitzende und als Opferhelferin selbst aktiv im Fall Högel, versicherte darin den Empfängern: „Weder sind wir in die Konzeption des Films eingebunden, noch fördern wir das Projekt in materieller Hinsicht. Wir begrüßen aber ausdrücklich, dass sich die Dokumentarfilmerinnen Gedanken über die möglichen Konsequenzen ihres Projekts für Betroffene machen und sich die Frage stellen, was dieser Film bei Opfern und Angehörigen auslösen könnte.“ Wer von ihnen mehr Infos wünsche, Interesse an dem Vorab-Screening habe oder sonstigen Gesprächsbedarf sehe, könne sich beim WEISSEN RING melden.
Karsten Krogmann
Der #TrueCrimeReport: Alle Texte im Überblick
- Aus der Bahn geworfen: Die dunkle Seite des True-Crime-Booms
- Fakten: Die sieben wichtigsten Erkenntnisse unserer Recherche
- Exklusive Datenanalyse: Hauptsache tot
- Wie alles begann: Eine Mords-Geschichte
- Christian Schertz: „Opferrechte bleiben auf der Strecke“
- Ingrid Liebs: „Ich brauche die Öffentlichkeit“
- Umfrage: Wie gehen True-Crime-Macher:innen mit Betroffenen um?
- Christian Solmecke: Was True-Crime-Formate dürfen – und was nicht
- Nahlah Saimeh über den „potenziellen Gewalttäter in uns selbst“
- Johann Scheerer: „Befriedigung einer Schaulustigen-Mentalität“
- Zeit Verbrechen: „Scherben aufkehren, die andere zurücklassen“
- „Mordlust“: Warum sie die Perspektive gewechselt haben
- Erfahrungsbericht: Ist True Crime sinnvoll oder voyeuristisch?
- OMR: Marketing-Experte erklärt, warum Podcasts so beliebt sind
- Torsten Körner: „True Crime ist was für Feiglinge“
- Fall Högel: Die ungewöhnliche Anfrage eines Fernseh-Teams
- Presserat: Bisher nur eine Rüge für True-Crime-Format
- Hintergrund: Wie die Redaktion recherchiert hat
- Audiostory: Aus der Bahn geworfen
- Audiostory: Ingrid Liebs über ihre Erfahrungen mit True-Crime-Formaten
- Forum Opferhilfe: Das Magazin
- Deutsche Ausgabe (PDF-Format)
- Englische Ausgabe (PDF-Format)