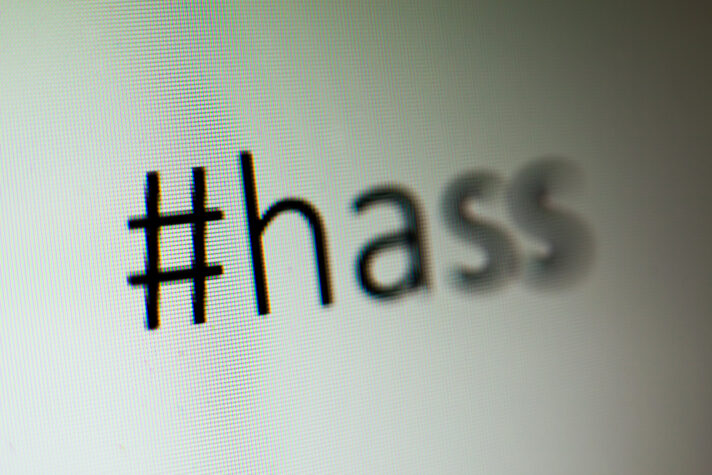Als die Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt im Mai 2023 in Berlin ihre Jahresbilanz vorstellen, werden die Mitglieder der Bundespressekonferenz mit erschreckenden Zahlen konfrontiert. Bei rechten Gewalttaten gab es demnach im vergangenen Jahr einen Anstieg um 15 Prozent. Insgesamt wurden allein in den zehn Bundesländern, in denen es solche Beratungsstellen gibt, mehr als 2.000 Angriffe aus rechten, rassistischen und antisemitischen Motiven registriert. Das sind durchschnittlich mehr als fünf Angriffe pro Tag. Von der verbalen und körperlichen Gewalt waren 2.871 Menschen betroffen. Ein Detail erregt bei der Pressekonferenz besondere Aufmerksamkeit: Demnach gab es im Vergleich zum Vorjahr fast doppelt so viele Kinder und Jugendliche (522 nach 288 im Jahr 2021), die aus rassistischen Gründen angegriffen wurden.
Raus aus der Opferrolle
Neben Robert Kusche vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (VBRG) sitzt an diesem Tag eine junge Frau vor der Hauptstadt-Presse. Sie spricht mit fester, eindringlicher Stimme. Erklärt, dass Rassismus für Kinder und Jugendliche mit einer anderen Herkunft hierzulande allgegenwärtig ist. Dass viele dieser jungen Leute Anfeindungen und sogar Angriffe erleben. Die junge Frau heißt Sultana Sediqi. Der 19-Jährigen gelingt es, dass aus anonymen Zahlen menschliche Schicksale werden. Später wird sie berichten, wie aufgeregt sie war, vor die Kameras zu treten. Mit ihren klaren Worten schafft sie es an diesem Tag in die „Tagesschau“.
Wenn Sultana öffentlich über unerträgliche Zustände spricht, dann tut sie das nie aus einer Opferrolle heraus. Man hört Wut, Leidenschaft, Stärke und Verletzlichkeit – aber immer auch eine junge Frau, die selbstbewusst Respekt, Rechte und Teilhabe für diejenigen einfordert, die als Geflüchtete oder Migranten nach Deutschland kamen. Seit einigen Jahren engagiert sie sich im Verein „Jugendliche ohne Grenzen“ und gibt bei Demos, öffentlichen Podien und Workshops denen eine Stimme, die ansonsten kaum gehört und üblicherweise mit ihren Problemen und Bedürfnissen übersehen werden.
Flucht aus Afghanistan
Sultana ging noch nicht lange zur Schule, als ihre Familie vor dem Krieg in Afghanistan flüchtete. Mit der Mutter, dem Vater und ihrer Schwester machte sie sich auf den Weg in die Türkei und nach Griechenland und landete schließlich in einem kleinen Ort in Thüringen: Breitenworbis. In einer Sammelunterkunft, die Sultana „Lager“ nennt und die mittlerweile geschlossen ist. Fotos aus dem Internet zeigen ein schmuckloses Haus mit sterilen Fluren und kahlen Räumen. Sultana sitzt in einem Café in Erfurt. Sie hat sich bereit erklärt, der Redaktion des WEISSEN RINGS ihre Geschichte zu erzählen und jene schmerzhaften Erfahrungen zu teilen, die sie als Schülerin dazu brachten, sich für Menschenrechte und Teilhabe sowie gegen Hass und Ausgrenzung zu engagieren. Sie erinnert sich noch gut an ihre Kindheit in Breitenworbis. Daran, wie sie mit Mädchen und Jungen verschiedener Herkunft tagsüber draußen unterwegs war und sich mit ihnen über alle Sprachbarrieren hinweg eine eigene Fantasiewelt erträumte. Weil sie immer vorneweg lief, wurde sie von den anderen scherzhaft „der Boss“ genannt. „Rückblickend war das meine beste Zeit in Deutschland“, sagt sie. Einerseits.
Andererseits erinnert sie sich an Enge, Angst, und permanente Unsicherheit. Jede Familie hatte nur ein Zimmer, das Bad mussten sie sich mit vielen Unbekannten teilen. „Ständig gab es Konflikte“, sagt Sultana. Immer wieder kam es unter Männern zu Schlägereien. Nachts hörte sie Schreie von denen, die abgeschoben werden sollten. Auch eine ihrer Freundinnen wurde abgeholt. Lange seien sie in dem Wissen eingeschlafen: „Dich kann es als Nächste treffen.“ Die Security-Leute erlebte Sultana als willkürlich und desinteressiert. „Über zwei Monate hatte ich einen gebrochenen Arm und niemand hat sich darum gekümmert“, sagt sie. Ein Geflüchteter sorgte schließlich dafür, dass doch noch ein Krankenwagen kam und ihr Arm medizinisch versorgt wurde. In ihrer Erinnerung waren es zwei lange und widersprüchliche Jahre in Breitenworbis. Sultana weiß noch, wie ihre Mutter irgendwann jubelnd durch das Haus lief und mit einem Briefumschlag wedelte. Darin die erlösende Nachricht mit dem Aufenthaltstitel für drei Jahre. Mittlerweile besitzt Sultana eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, lebt mit ihrer Familie in einer kleinen Wohnung und hat die deutsche Staatsagehörigkeit beantragt. Auf einem Gymnasium hat sie Abitur gemacht und spricht besser Deutsch als viele, die hier geboren sind. Ein vorläufiges Ende, ja, aber es ist nicht alles gut.
Bespuckt, geschlagen, bedroht
Obwohl für Sultana vieles einfacher und besser geworden ist, seit sie mit ihrer Familie aus dem fernen Kriegsgebiet kam, hat sie doch einen ständigen Begleiter, der ihr hier das Leben schwer macht: Rassismus. Der sorge im Alltag für ein permanentes Gefühl der Unsicherheit, sagt sie. Beim Arzt, beim Friseur, in der Straßenbahn, wenn eine alte Frau ohne erkennbaren Grund aufsteht und sich von ihr wegsetzt. Als rechte Gruppen einen heißen Herbst ausriefen und auf Demos massiv gegen Geflüchtete mobilisiert wurde, bekam Sultana das in ihrem Umfeld zu spüren. Eine Mutter aus Afghanistan erzählte, der siebenjährige Sohn wache nachts weinend auf, weil die Grundschulkinder ihm klargemacht hätten: Du gehörst nicht hier hin! Eine andere afghanische Mutter vertraute ihr an, dass ihr 15-Jähriger Sohn im Supermarkt bespuckt und geschlagen worden sei. Nach solchen Gesprächen fühlt Sultana eine große Ohnmacht.
Wie anfangs beschrieben, schrecken rassistische Täter nicht vor Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zurück.
Einige Beispiele, von denen viele unterhalb des öffentlichen Radars blieben:
- Eine ältere Frau attackierte in der Berliner S-Bahn zwischen den Stationen Hauptbahnhof und Friedrichstraße eine schwarze Mutter und deren Sohn. Die Angreiferin trat mehrfach auf die Füße des Kindes. Als die Mutter einschritt, wurde sie mit ihrem Sohn körperlich angegriffen. Ein umstehender Mann beleidigte die Opfer rassistisch. Weitere Mitfahrende solidarisierten sich mit der Täterin.
- Eine unbekannte Frau im Alter von etwa 50 bis 60 Jahren schlug an einer Bushaltestelle im Berliner Stadtteil Dahlem ein dreijähriges Mädchen aus rassistischen Motiven unvermittelt mit der Handtasche ins Gesicht. Als die Mutter eingriff, wurde sie von der Angreiferin rassistisch beleidigt.
- Ebenfalls in Berlin, im Senftenberger Ring, näherten sich eine Frau und ein Mann, die Fahrräder schoben, einer Gruppe spielender Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren. Die Erwachsenen beschimpften die Kinder mit rassistischen Beleidigungen. Die Frau spuckte nach ihnen und traf zwei der Kinder. Die Täter entkamen, bevor die Polizei eintraf.
- In Berlin-Lichtenberg ging eine Frau mit ihren Kindern zum Spielen in den gemeinschaftlich genutzten Garten des Mietshauses. Eine Nachbarin, die dort mit anderen grillte, beleidigte die Familie aufgrund ihrer Hautfarbe. Ein Mann aus der Grillrunde schüttete der fünfjährigen Tochter Bier über den Kopf.
- Das Amtsgericht Tiergarten verurteilte mehrere Erwachsene wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung zu Bewährungs- und Geldstrafen. Eine zur Tatzeit 17-jährige türkischstämmige Jugendliche war in einer Straßenbahn rassistisch beleidigt worden. Als Täter und Opfer ausstiegen, schlug eine der Angeklagten die minderjährige Abiturientin und zog sie an den Haaren. Das Opfer leidet seither unter Angst und Albträumen.
- In Hoyerswerda (Sachsen) bewarfen zwei mittelalte weiße Männer aus einem Wohnblock heraus eine Gruppe von Jugendlichen mit einem Böller. Der Sprengkörper detonierte unmittelbar neben der Gruppe, die sich auf einer Reise im Rahmen eines Projekts für das Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft befand.
- Eine Schulklasse aus Berlin wurde in einer Ferienanlage in Brandenburg derart massiv rassistisch beleidigt und bedroht, dass sie die Klassenfahrt abbrach. Die Angreifer waren nach Angaben der Betroffenen teilweise vermummt und hatten offenbar versucht, in die Anlage zu gelangen.
Den auf rechte und rassistische Gewalt spezialisierten Opferberatungsstellen mit ihren niedrigschwelligen Angeboten, Chroniken und Pressemitteilungen ist es zu verdanken, dass derartige Angriffe gegen Minderjährige überhaupt dokumentiert und wahrgenommen werden. Sultana Sediqi erschütterte eine solche Tat derart, dass sie sich traute, in die Öffentlichkeit zu treten. In einer Erfurter Straßenbahn hatte ein erwachsener Mann einen syrischen Jungen drangsaliert und brutal zusammengeschlagen. Nachdem sie das Video von der rassistisch motivierten Tat gesehen hatte, wusste Sultana, dass sie nicht länger schweigen konnte.
„Wir sind die Gesellschaft!“
Ein Bekannter bot ihr an, auf einer Demo in Erfurt zu sprechen. Familie, Freunde und Lehrer hatten Angst und beschworen sie, es nicht zu tun. Was, wenn sie danach selbst bedroht oder angegriffen würde? Sultana setzte sich über alle Bedenken hinweg. Als sie ans Mikro trat, sprach sie über die Angst und ihre Wut und auch über Hoffnung: „Ich möchte, dass wir den Rassisten nicht unseren Hass schenken und erst recht nicht unsere Angst.“ Sie sprach davon, dass dieser brutale Schläger nicht für alle in der Gesellschaft stehe. Sie erzählte von ihren deutschen und ausländischen Freunden und erklärte, dass diejenigen, die irgendwann nach Deutschland kamen und hier leben, lernen und arbeiten, keine Gäste seien. „Wir sind die Gesellschaft, und wir lassen uns nicht auseinanderdividieren!“ rief Sultana den Demonstrierenden zu. „Wir alle gehören zu dieser Welt. Zu Europa. Zu Deutschland. Zu Erfurt.“ Am Ende ihrer Rede forderte sie einen Aufstand. Einen Aufstand für Mitgefühl und Respekt.
Ihre Worte trafen den richtigen Ton, mehr noch, sie trafen einen Nerv. Danach erhielt sie viel Zuspruch und lernte beim Verein „Jugendliche ohne Grenzen“ andere junge Leute und deren Migrationsgeschichten kennen. Bei ihren Treffen teilen sie nicht nur Erfahrungen über alltäglichen Rassismus, sondern auch Probleme mit der Ausländerbehörde, Duldungsfragen und Schwierigkeiten, respektiert zu werden. Seither wird Sultana oft zu Workshops und Diskussionen eingeladen. Sie ist eine Sprecherin für junge migrantische Perspektiven geworden. Für viele mit einer ähnlichen Biografie ist sie ein Vorbild, wie Kommentare auf ihren Social-Media-Kanälen zeigen. Aber der Verklärung ihrer Geschichte zum migrantischen Erfolgsmodell entzieht sie sich. Dafür hat sie zu schmerzhaft erfahren, dass es auch ganz anders ausgehen kann.
Ein Unglück, das Sultana noch mehr antreibt
Sultana war gerade in der Schule, als sie die schreckliche Nachricht erhielt. Ihre Verwandten hatten sich von Griechenland aus auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer nach Italien gemacht. In der Nacht vom 5. Oktober 2022 kenterte ihr Boot. Sultanas Tante hat überlebt, ihr Onkel nicht. Die Angst und der Horror, nahe Angehörige zu verlieren, seien wahr geworden, erzählt Sultana. „Lähmung und Ohnmacht“ habe sie empfunden. Danach reisten einige Familienmitglieder auf die griechische Insel Kythira. Die Familie identifizierte den Leichnam des Onkels, Sultana trauerte mit ihnen bei der muslimischen Beerdigung in Griechenland. „Ich habe versucht, Solidarität aufzubauen“, erinnert sich Sultana an die Zeit danach. Sie startete eine Spendenaktion, erzählte in Interviews vom Tod ihres Onkels und organsierte mit einer Unterstützergruppe eine große Informationsveranstaltung in Erfurt: „Ein Meer voller Tränen“. Da erzählten sie den vielen Interessierten an diesem Abend, wie es ist, Angehörige auf dem Mittelmeer zu vermissen – und wie es ist, sie zu verlieren. „Es gab viel Raum für geflüchtete Menschen, ihre Geschichte zu erzählen“, sagt sie. Ungewöhnlich viele waren gekommen, um zuzuhören. Einige sprachen Sultana danach an und sagten, sie wollten jetzt auch selbst etwas tun. Bei allem Schmerz war es ein Abend der Hoffnung. „Einmalig für Erfurt“, sagt Sultana.
Seitdem ist viel passiert. Rechte Gewalt nimmt zu. Europa schottet sich immer stärker gegen Geflüchtete ab. Vieles von dem, wovor Sultana warnt, wird derzeit schlimmer, nicht besser.
Ein lauer Abend in Berlin. Am Kanzleramt hat sich eine Menschentraube zumeist junger Leute zu einer Kundgebung von „Jugendliche ohne Grenzen“ gegen die europäische Asylpolitik versammelt. Einige halten Transparente. Selbst gemalte Schilder fordern „Solidarität statt Brutalität“. Auf der Ladefläche eines roten Lastwagens tritt Sultana ans Mikrofon: „Ihr Lieben, ich bin Sultana.“ Noch nie habe sie eine „so schmerzhafte Ohnmacht und Hilflosigkeit“ verspürt. Einen Tag zuvor ist vor der griechischen Küste ein Schiff mit vielen Familien und Kindern an Bord gekentert. Mehr als 500 Menschen kamen dabei ums Leben. Überlebende haben schwere Anschuldigungen gegen die griechische Küstenwache erhoben. In der Woche vor dieser Katastrophe hat die EU beschlossen, Schutzsuchende künftig verstärkt in Lagern an den Außengrenzen Europas aufzuhalten.
„Wir geben nicht auf!“
Vor dem Kanzleramt kann und will Sultana ihre Wut nicht zügeln. Sie prangert die „Entwürdigung“ von Menschen an, „die vor Krieg und Folter fliehen“. Diese seien „uns weniger fremd als wir glauben“. Scharf kritisiert sie die allgemeine Gleichgültigkeit gegenüber dem massenhaften Sterben auf den Wegen nach Europa an. Eindringlich spricht sie über „strukturelle Isolation“ in Lagern: „Dieses vegetierende Leben macht die Leute krank. Nicht physisch, sondern seelisch.“ Sultana erinnert daran, dass Kinder unter diesen Verhältnissen ganz besonders leiden, weil solche Sammellager Gewalt förderten. Sie weist auf einen Widerspruch hin. Einerseits würden derzeit in aller Welt Fachkräfte angeworben. Andererseits begegne man hierzulande Menschen, die unter großen Mühen versuchen, sich eine Existenz aufzubauen, mit Ausgrenzung und Repression. Zwischendurch bricht kurz ihre Stimme weg. Ihre Rede endet mit einem kämpferischen Appell, die Menschenrechte zu achten und die Demokratie zu verteidigen. „Wir geben nicht auf!“, ruft sie. „Wir hören nicht auf, laut zu sein, bis wir die Utopie einer besseren und gerechteren Welt wahr werden lassen!“ Trotz mischt sich an diesem Abend mit dem Mut der Verzweiflung.
Als die junge Erfurterin unter lautem Jubel vom Wagen klettert, kommen Gleichgesinnte und nehmen sie in den Arm. Sultana wirkt, als sei eine große Last von ihr abgefallen. Sie strahlt. Als sich wenig später die Demo mit einigen Hundert Teilnehmenden vom Kanzleramt in Richtung Hauptbahnhof in Bewegung setzt, läuft Sultana Arm in Arm mit einer Freundin. Aus Lautsprechern schallt fröhliche Musik. Einige in dem Demo-Zug bewegen sich tanzend im Rhythmus der Musik weiter. Die jungen Leute protestieren nicht nur, sondern sie feiern sich auch dafür, dass sie ihre Wut und Wünsche auf die Straße tragen. Doch sie bleiben unter sich. Bis zur Abschlusskundgebung nehmen nur wenige Passanten überhaupt Notiz von ihnen. Auf der anderen Seite der Spree sitzen Touristen und Büroleute in den Liegestühlen einer Bar und genießen im weichen Abendlicht bunte Cocktails. Sultana und die anderen bleiben eine Randerscheinung. Aber das ist ihr egal. „Solche Demos dienen erst mal dazu, die Community zu stärken und füreinander da zu sein“, erklärt sie. „Da geht es gar nicht darum, Zuspruch von außen zu bekommen.“ Trotz aller Hiobsbotschaften der jüngsten Vergangenheit ist sie nach der Demo geradezu euphorisch. Sie ist nicht allein, auch wenn die große Mehrheit nichts von ihren Sorgen und Forderungen wissen will.
Sie gibt Betroffenen eine Stimme
Am nächsten Morgen sitzt Sultana in einem Stuhlkreis. Der Verein „Jugendliche ohne Grenzen“ hat zur Jahreskonferenz in ein kleines Berliner Theater eingeladen. Die Wut vom Abend ist verflogen, das Kämpferische großer Nachdenklichkeit gewichen. Bevor sie sich auf verschiedene Workshops verteilen, sprechen sie in großer Runde über die Demo und die aktuelle politische Lage. Sultana bekommt einen warmen Applaus für ihre Rede. Offenbar hat sie vielen aus der Seele gesprochen. Sie sagt, sie sei „überwältigt von dem Zusammenhalt und der Solidarität“ hier in Berlin. „Wir feiern uns mit Musik. Das nehme ich auf jeden Fall mit nach Erfurt.“ Danach übersetzt sie für einen schüchternen 24-Jährigen, der wie sie aus Afghanistan kommt und seine Gefühle ausdrücken möchte. Er habe sehr viel Angst gehabt, heute herzukommen. Nun sei er froh, da zu sein: „Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, eine Stimme zu haben.“
Es dauert nicht lange, und sie landen doch wieder beim Thema Rassismus. Ein junger Mann aus Osnabrück berichtet, wie jemand auf der Straße gleich zweimal nach ihm gespuckt habe. Das hat ihn schockiert. Nicht so sehr die Tat selbst. Von Älteren habe er schon mal zu hören bekommen: Alle Schwarzhaarigen seien Terrorristen. Aber der spuckende Mann war nach seiner Einschätzung erst Mitte zwanzig. Solchen Hass hat er unter jungen Deutschen nicht vermutet. Die Jugendlichen im Stuhlkreis hören sich gegenseitig zu, sprechen sich Mut zu, diskutieren Strategien. Einer schlägt vor, eine Resolution an den Bundestag zu schreiben, um auf die Probleme junger Geflüchteter aufmerksam zu machen. Sie diskutieren, ob Workshops und Podien mit rassistisch eingestellten Menschen sinnvoll sind oder nicht. Der Moderator wirbt dafür, sich auf diejenigen zu konzentrieren, die offen genug sind, eigene Vorurteile zu korrigieren. Überzeugte Rassisten könne man nicht ändern. Sie sammeln Ideen und Erfahrungen, aus denen in Hamburg, Nürnberg und Erfurt neue Projekte werden könnten. Als sich dann im großen Theatersaal alle ein Hütchen aufsetzen und für ein Jubiläums-Foto posieren, wirkt es für einen Moment, als seien sie in diesem Deutschland angekommen.
Helfen, vernetzen, aktiv bleiben
Am Montag nach dem Wochenende in Berlin lässt Sultana zum Interview in Erfurt auf sich warten. Als sie nach einer Weile eintrifft, entschuldigt sie sich für die Verspätung. Eben noch hat sie eine alleinerziehende Mutter aus Afghanistan, die dringend mehr Wohnraum benötigt, zu einer Wohnungsbesichtigung begleitet. Manchmal hilft es, wenn sie bei solchen Terminen dabei ist. Heute hat es leider nicht mit einem Mietvertrag geklappt. Der Alltag hat sie wieder: helfen, vernetzen, aktiv bleiben – auch und gerade in schwierigen Zeiten. In Kürze will sie mit einer Freundin auf die Insel Kythira fliegen, um in Griechenland eine Erinnerungsveranstaltung vorzubereiten zum Jahrestag des Unglücks, bei dem ihr Onkel starb. Ein Lehrer habe mal zu ihr gesagt: „Du musst einsehen, dass du die Welt nicht verändern kannst.“ Sultana versucht, jede Gelegenheit zu nutzen, um zu beweisen, dass er sich irrt. Mögen die Veränderungen auch noch so klein und unbedeutend erscheinen.
Michael Kraske