Da sitzt der Mann im Gericht in Hildesheim, im Schwurgerichtssaal, was der größte Raum in diesem Justizbau ist. Leicht übergewichtig ist er, kariertes Hemd, Jeans, von seinem Verteidiger getrennt durch eine Plexiglasscheibe. Vor der breiten Fensterfront blühen an diesem Tag Ende Mai Kastanien, die Sonne scheint.
Am 17. Dezember 2020 attackiert er in Peine aus dem Nichts heraus zwei Frauen. Eine 70-jährige Rentnerin, die an fünf Tagen in der Woche körperlich behinderte Menschen zu ihrer Arbeit fährt. Und eine Frau, die sie gerade transportiert hat und nun an ihrer Wohnung herauslassen will. Das sind die Opfer. Die Fahrerin, zierlich, weißhaarig, gepflegt, steigt aus, geht um den Wagen herum. Aus der Entfernung sieht sie einen Mann in ihre Richtung laufen, er trägt einen Kapuzenpulli, ungewöhnlich ist an dem Bild nichts. Sie will den Rollator aus dem Kofferraum holen. Als sie hinten am Wagen ist, wird sie an den Haaren gezogen. „Dann“, sagt die Frau später in der Zeugenvernehmung, „bekam ich einen Faustschlag ins Gesicht. Von dem Moment an weiß ich nichts mehr.“
Sie wird, so steht es in der Anklageschrift, „wuchtige Tritte gegen den Oberkörper“ erhalten. Der Täter, 29 Jahre alt, geht danach auf die Frau los, die gerade vor dem Hochhaus ihren Rollator bekommen sollte, um auszusteigen. Er zerrt sie aus dem Wagen, laut Oberstaatsanwalt kommt es zu „wuchtigen, stampfenden Schritten auf den Kopf“. Er wendet sich wieder der Fahrerin zu, es folgen Tritte gegen den Kopf. Ein Zeuge, der Teile der Tat aus dem sechsten Stock beobachtet hatte, wird die Tritte später so beschreiben: „Als ob man einen Elfmeter schießen würde. Mit voller Wucht.“
Überleben der Frauen pures Glück
Dass die Frauen noch leben, ist pures Glück. Der Tatvorwurf lautet zweifacher versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Verhandelt wird hier heute aber das Delikt „vorsätzlicher Vollrausch“. Der Täter hatte vor der Tat, so wird es sein Verteidiger schildern, drei 0,33-Liter-Dosen eines Whiskey-Cola-Gemischs getrunken. Er hat das Medikament Diazepam geschluckt. Diazepam ist ein Medikament aus der Gruppe der Benzodiazepine, das gegen Angst- und Erregungszustände eingesetzt wird. Ein Psychopharmakon, das auf keinen Fall zusammen mit Alkohol eingenommen werden sollte, da diese Mischung die Wirkung des Medikamentes drastisch verändern kann. Eine Flasche Weinbrand soll der Mann anschließend getrunken haben. Und das Letzte, woran er sich laut seinem Anwalt erinnern kann, ist eine Flasche Apfellikör in seiner Hand, „dann keine Erinnerung mehr“.
Der Mann handelt im Vollrausch. Und ist damit schuldunfähig für diesen Gewaltexzess. Damit das Verbrechen nicht ungesühnt bleibt, wird in Hildesheim ein „Auffangstatbestand“ verhandelt. So nennt es der Gerichtssprecher kurz vor der Verhandlung. Eben jener „vorsätzliche Vollrausch“. Dafür sieht die Gesetzgebung eine Strafe von maximal fünf Jahren vor. Gefährliche Körperverletzung allein kann mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren bestraft werden. Der Anwalt des Mannes wird später sagen: „Wir wollen die Schuld nicht auf den Alkohol schieben, schuld ist man zuallererst einmal allein.“

Eine juristische Krücke
Wenn das so ist, kann der Alkoholkonsum dann strafmildernd wirken? Ein Grundsatz der deutschen Rechtsprechung lautet: keine Strafe ohne Schuld. Und zwischen Schuld und Schuldunfähigkeit steht dann noch die verminderte Schuldfähigkeit. Anders formuliert: Begeht ein Mensch eine Straftat, stellt sich die Frage, in welchem Zustand er war. War er zurechnungsfähig, wird er nach den geltenden Gesetzen bestraft. War er vermindert schuldfähig, macht sich das beim Strafmaß bemerkbar, es sinkt. War er unzurechnungsfähig, zum Beispiel durch einen Vollrausch, muss er für die eigentliche Tat keine Strafe fürchten. Ein solcher Rausch liegt bei mindestens 3,0 Promille Blutalkoholkonzentration vor. Der Täter kann aber für den vorsätzlichen Vollrausch, in dem die Tat geschah, bestraft werden.
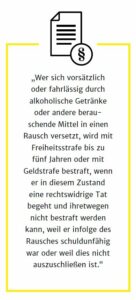
So gesehen ist der zugrunde liegende Paragraph des Strafgesetzbuches (StGB) eine juristische Krücke, die es in dieser Form schon länger gibt: Um einen Täter auch nach einer Rauschtat bestrafen zu können, wurde durch ein Gesetz vom 24. November 1933 der Straftatbestand des Vollrausches in das StGB aufgenommen. Im Jahr 2000 wurde der heute gültige Paragraph 323 a in seine aktuelle Form gebracht:
„Wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel in einen Rausch versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist.“
Verheerende Verletzungen und psychische Folgen
„16.20 Uhr? Das kann so hinkommen“, sagt das Opfer, als der Richter nach der Tatzeit fragt. Später im Krankenwagen kommt die Frau kurz zu sich, dann verliert sie wieder das Bewusstsein, wird erst wieder im Krankenhaus wach. Das ganze Gesicht geschwollen, die Nase gebrochen, das linke Ohr aufgeplatzt, fünf Tage bleibt sie in der Klinik.
Im Entlassungsbericht wird stehen: Nasenbeinfraktur, Felsenbeinfraktur, Blutkrusten auf dem Trommelfell, äußere Nase schiefstehend. Eigentlich soll sie deswegen noch an der Nase operiert werden, „da hatte ich panische Angst und habe die Operation abgelehnt“. Teilweise hat sie heute noch Kopfschmerzen, Nackenbeschwerden auch.
Wie es ihr heute seelisch geht, will der Richter wissen. Schlecht, sagt die Frau. „Ich bin in therapeutischer Behandlung und habe panische Angst, wenn jemand dicht hinter mir geht – dann kommt das alles wieder hoch.“ Im nervenärztlichen Bericht werden ihr vermehrte Panikattacken und eine posttraumatische Belastungsstörung attestiert.
Nicht mehr als Erinnerungsinseln
Bevor die Frau als Zeugin aussagt, äußert sich der Rechtsanwalt des Täters. Er spricht nach dem Oberstaatsanwalt, der die Anklageschrift verliest. Der Verteidiger sagt, dass „das, was objektiv vorgelesen wurde, von meinem Mandanten eingeräumt wird. Problematisch ist die subjektive Seite.“ Die Erinnerungen seines Mandanten passten nicht immer. Er habe sich in den fünfeinhalb Monaten in Untersuchungshaft Erinnerungsinseln erobert. „Zu dem Davor und dem Danach können wir etwas sagen. Zu dem Mittendrin nicht.“
Wenige Tage vor der Tat habe sein Mandant einen Unfall gehabt, bewusstlos sei er gewesen, mit einer starken Kopfverletzung und alkoholisiert im Krankenhaus, habe sich dort gegen den ärztlichen Rat entfernt, sei Stunden später wieder als hilflose Person aufgegriffen worden, wieder in ein Krankenhaus gekommen, wieder raus, dann habe er mehrere Tage im Bett gelegen und das auch nicht für einen Toilettengang verlassen.
Dann schließlich war er in Behandlung, auf dem Rückweg wollte er sich Verpflegung kaufen. Da gab es im Supermarkt ein Angebot: drei Whiskey-Cola-Getränke zum Preis von zwei.
„Völlig aus der Kontrolle geraten“
Ein Vater und sein Sohn renovierten an jenem 17. Dezember 2020 in Peine eine Wohnung in einem Hochhaus. Die Wohnung sollte für den Sohn sein, sie verlegten Laminat. Irgendwann wurde der Vater aufmerksam, von unten schallte lautes Gerede nach oben, dann wurde herumgebrüllt. Erst habe er das gar nicht so wahrgenommen, die Wohnung liegt im sechsten Stock. Dann schaute der Mann doch aus dem Fenster. „Ich habe dann erst einmal nur diesen roten Transporter gesehen, ein Mann schrie da herum, ich konnte es nicht verstehen, nur ein ‚Ihr seid doch alle gleich‘. Das hat er mehrfach gesagt.“
2018 wurde der Vollrausch-Paragraph 323a Wahlkampf-Thema in Sachsen, im Freistaat wollte das CDU-geführte Justizministerium das Strafgesetzbuch ändern. Selbst verschuldeter Rausch sollte nicht mehr generell strafmildernd wirken. Die Gesetzesinitiative scheiterte im Bundesrat und wurde dort abgelehnt.
2018, sagt der Täter, sei es bei ihm „völlig aus der Kontrolle geraten“.
Ein Drehtürpatient
Alkohol spielte im Leben des Täters von Beginn an eine bestimmende Rolle, auch als er selber noch nicht getrunken hat. Der Vater, so sagt es der Mann, war schwerer Alkoholiker, und verließ die Familie, als er selber ein Jahr alt war. Probleme bei ihm, ADHS, Schullaufbahn auf einer Grund- und Hauptschule „mit Augenmerk für Kinder mit einem Handicap“, Abschluss, Ausbildungsbeginn als Kfz-Mechatroniker. Abbruch nach zweieinhalb Jahren, näher an ein bürgerliches Leben sollte er nie herankommen.
Spätestens hier, im Alter von 17 Jahren, wurde der Alkohol die einzige Konstante im Leben des Mannes. Zwei weitere erfolglose Ausbildungsversuche, teilweise Obdachlosigkeit. Einmal, sagt er, sei er sieben Monate abstinent gewesen, das „Leben lief gut“. Dann habe seine damalige Lebensgefährtin ihn verlassen. Alkoholkonsum, exzessiv. Ecstasy, Kokain, Cannabis. Der Richter in Hildesheim folgt den Ausführungen und fasst diese Zeit später als „verdichtete Phase“ zusammen.
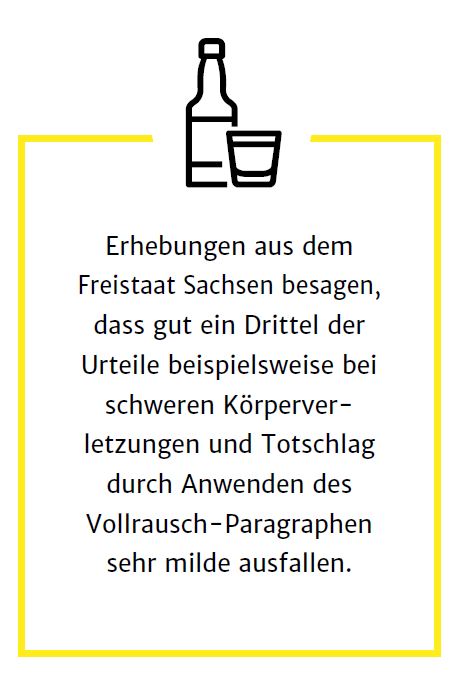
Ein Leben im Rausch mit entsprechenden Folgen und folgerichtig ein Leben in dem, was diese Gesellschaft „Hilfesystem“ nennt: Wohnprojekte, Sozialarbeiter, Therapien. Der Mann, der in seinem Auftreten jünger als seine 29 Jahre wirkt und oft während der Befragung stark mit seinen Füßen in den grauen Turnschuhen wippt, sagt, er sei 22-mal in Therapie in Königslutter gewesen. Er nennt sich selber einen Drehtürpatienten. Tür auf, Patient rein, Tür dreht sich weiter, Patient wieder da. Mal drehte sich die Tür nach wenigen Stunden, mal nach wenigen Tage oder Wochen. 21-mal kam er wieder durch die Tür zurück. Der Erfolg blieb aus.
Im Juni 2020 wurde er in Peine hilflos aufgefunden, zuerst Rettungskräfte, dann Polizei. Er leistete Widerstand. Im November deswegen eine Verhandlung wegen „vorsätzlichen Vollrauschs“. Verurteilt zu einer Bewährungsstrafe, mit einer Therapie als Bewährungsauflage. An die Therapie-Auflage kann sich der Mann nicht erinnern, der Richter spricht sie an, der Mann entgegnet: „Das ist jetzt komplett neu für mich.“
Eine Suchtbiographie
Die Biographie, die hier geschildert wird, ist eine Suchtbiographie. Der Richter will es genau wissen, fragt nach Rückfällen, Jahreszahlen, Verhältnissen und Umständen. Nach Mengen, Substanzen und Zuständen. Fragt letztlich nach Gründen, fragt wie immer auch nach dem Warum. Warum werden zwei Menschen derart attackiert? Eine Rentnerin, die behinderte Menschen fährt, um ihre Rente aufzubessern. Und eine körperlich behinderte Frau, die, um sich fortzubewegen, einen Rollator braucht und an diesem ersten Verhandlungstag nicht aussagen wird.
Braucht es Gründe für die Tat? Ist das wichtig für die Opfer? Ist es wichtig für eine Frau, ob sie von einem komplett bedröhnten Menschen zusammengetreten wird? Oder von einem nüchternen? Wenn ein Kind totgefahren wird, ist es dann nicht für die Eltern komplett egal, ob der Fahrer betrunken war oder berauscht, nüchtern oder vielleicht eine SMS gelesen hat, als er das Kind überfuhr? Die Folgen sind so oder so unerträglich. Sucht ist eine Krankheit. Aber wer kann etwas dafür, dass eine andere Person krank ist?
Braucht es ein Recht wie in Schweden oder Norwegen?
Im angelsächsischen Raum sowie in Schweden und Norwegen wird von den dortigen Gerichten ein selbstverschuldeter Rauschzustand grundsätzlich nicht als Strafmilderungsgrund angesehen. Das war auch in der früheren DDR so. Grundlage dieses Gedankens ist es, dass im Gegensatz zu sonst schuldausschließenden psychischen Störungen, die den Täter unverschuldet heimsuchen, der Alkohol- und Drogenrausch regelmäßig auf einer freiverantwortlichen Entscheidung des Täters beruht.
Als in Sachsen 2018 versucht wurde, die Strafmilderung von Rauschtaten zu kippen, wurde dort in der öffentlichen Diskussion als Argument eingeführt, dass laut Erhebungen aus dem Freistaat gut ein Drittel der Urteile beispielsweise bei schweren Körperverletzungen und Totschlag durch Anwenden des Vollrausch-Paragraphen sehr milde ausfallen. Der damalige Landesjustizminister der CDU nannte das „ein verheerendes rechtspolitisches Signal an potenzielle Straftäter“. Das mag sein. Aber ist die Frage nicht wichtiger, was damit für ein Signal an die potenziellen Opfer von Straftaten ausgesandt wird? Müssen sie nicht im Zweifel ein Leben lang mit den Tatfolgen leben?
„Wir wollen die Schuld nicht auf den Alkohol schieben, schuld ist man zuallererst einmal allein.“
Anwalt des Angeklagten
Beruhigungstabletten, Ergo- und Psychotherapie
Sechs Tage nach Prozessbeginn, an einem Dienstag, wird der Mann zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Zusätzlich wird seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Das Urteil ist rechtskräftig, weder Staatsanwaltschaft noch der Anwalt des Mannes legten Rechtsmittel ein.
Die Frau, die den Wagen fuhr, nimmt heute abends Beruhigungstabletten, „die helfen, man wird ruhiger dadurch, aber so fest wie früher schlafe ich heute nicht mehr.“ Sie geht zur Ergotherapie und lernt dort zusätzlich, ihren Körper durch Atemtechniken zur Ruhe zu bringen. „Dann noch die Psychologin, die mit mir spricht, spazieren geht, sie hat ihren Hund dabei, das hilft.“ Sie macht diese Therapie erst seit drei Wochen, es sei sehr schwer gewesen, einen Platz zu bekommen.
Inzwischen fährt sie auch wieder behinderte Menschen. Die ersten drei Tage habe sie dabei „wahnsinnige Schwierigkeiten“ gehabt, dann sei es langsam wieder gegangen. Es überhaupt wieder zu versuchen, dazu hatte man ihr in der Therapie geraten. Wenn es nicht gehen würde, könnte sie ja immer noch abbrechen. „Das sind ganz liebe Menschen, das bringt einem viel, ich mache das gern“, sagt die Frau.
Der WEISSE RING hat im Herbst 2019 folgende strafrechtspolitische Forderung aufgestellt: Schuldunfähigkeit und Schuldmilderung sollten beim selbstverschuldeten Alkohol- und Drogenrausch grundsätzlich nicht anerkannt werden.
Tobias Großekemper





