„Nichts für schwache Nerven“.
„Teils schwer auszuhalten“.
„Brutal“.
So wurde die Münchner „Tatort“-Episode „Schau mich an“ in den Kritiken beschrieben, die Anfang April 2024 erstmals ausgestrahlt wurde. Vom Einschalten hielten die Rezensionen kaum jemanden ab, im Gegenteil. Mehr als 8,5 Millionen Menschen sahen den Krimi um einen sadistischen Frauenmörder, der sein Opfer zerstückelt, in einem Koffer in der Kanalisation ablegt und ein Video der Tat und der vorangegangenen Folter ins Internet stellt. Mit mehr als 30 Prozent war der Marktanteil überdurchschnittlich; „herausragend“, ja „grandios“, berichteten Mediendienste später.
Gewalt, insbesondere gegen Frauen, bringt gute Einschaltquoten und viele Klicks in der Mediathek oder auf Streaming-Plattformen. Darum ist sie allgegenwärtig im Fernsehen, auch und besonders im fiktionalen Bereich, in Spielfilmen und Serien. Vor allem in Krimis, unter anderem in „Tatort“- und „Polizeiruf 110“-Episoden, in Thrillern und Dramen, außerdem in True-Crime Dokus sehen die Zuschauer regelmäßig explizite Bilder von körperlicher und sexueller Gewalt. Aber auch in Animationsfilmen, Nachrichten und Unterhaltungsformaten. In so gut wie jedem Genre findet man geschlechtsspezifische Gewalt, also Gewalt gegen eine Person aufgrund ihres tatsächlichen oder vermeintlichen Geschlechts, in der Regel: gegen Frauen. Die Opfer in Film und Fernsehen haben eines gemeinsam: Wer in Filmen und Serien geschlagen, vergewaltigt und ermordet wird, ist meistens weiblich.
2021 bestätigte eine Studie, die von der MaLisa-Stiftung initiiert und von der Hochschule Wismar und der Universität Rostock durchgeführt wurde, diesen Eindruck. Die Stiftung der Schauspielerin Maria Furtwängler und ihrer Tochter Elisabeth setzt sich unter anderem für gesellschaftliche Vielfalt ein. Der Analyse zufolge wird in 34 Prozent der Sendungen geschlechtsspezifische Gewalt gezeigt, oft als explizite und schwere Gewalt gegen Frauen und Kinder. Analysiert haben die Forscher eine repräsentative Stichprobe der Programme von acht Fernsehsendern, die 2020 zwischen 18 und 22 Uhr ausgestrahlt wurden.
Auch wenn die Zuschauer die Gewalt, wie in der genannten „Tatort“-Folge „Schau mich an“, nicht explizit sehen, so hören sie doch, wie das Opfer schreit. Und sie sehen, wie eine gefesselte, halbnackte Frau sich vor Schmerz windet, weil sie mit einer Zange und glimmenden Zigaretten gequält wird, die der Täter in die Kamera hält. Später sind die Wunden an ihrem Körper zu sehen.
Gewalt wird im Fernsehen heute etwas bewusster, dosierter und dezenter eingesetzt als noch vor ein paar Jahren. Dennoch gibt es ein Ungleichgewicht: weil Frauen im Fernsehen überproportional oft Opfer von Gewalt werden. Und wegen der Gründe dafür. Männerfiguren erfahren Gewalt, wenn sie sich in Gefahr begeben, wenn sie Verbrechen begehen oder aufklären, jemanden beschützen, in den Krieg ziehen, als Superhelden oder Bösewichte. Frauen werden Opfer von Gewalt und Mord, weil sie Frauen sind. Femizid nennt man Letzteres, in der Realität wird fast jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Das ist ein wichtiges Thema, doch im Fernsehen wird Gewalt gegen Frauen häufig voyeuristisch, ästhetisiert oder erotisiert dargestellt: mit einer Kamera, die oft aus Täterperspektive auf die aufgerissenen Augen und zappelnden Beine der Opfer hält.
Auf die Spitze getrieben hat das 2022 die Serie „German Crime Story: Gefesselt“ (Amazon Prime Video) über den Mann, den die Medien vor 30 Jahren den „Hamburger Säurefassmörder“ nannten. Er lockte drei Frauen in seinen selbst gebauten Bunker, quälte sie und tötete zwei von ihnen. Ihre Leichen löste er in Fässern mit Säure auf. Die Serie wird größtenteils aus Sicht des Täters erzählt, die Frauen stellt sie als Objekte aus: gefesselt, entblößt und erniedrigt.

unter anderem für die Süddeutsche Zeitung,
Zeit Online und Übermedien. Seit 2018 ist sie
Mitglied der Nominierungskommission Fiktion
des Grimme-Preises, aktuell als Vorsitzende. Foto: Georg Jorczyk (Grimme-Institut)
„German Crime Story“ ist ein Extrembeispiel, aber keine Ausnahme. In Fernsehkrimis sind Vergewaltigungs- und andere Gewaltszenen selbstverständlich. 2023 breitete die deutsche Netflix-Serie „Liebes Kind“ die Entführung einer Frau in quälend langen Rückblenden aus, in denen sie gedemütigt wird. Die Serie war ein internationaler Erfolg. Die deutsche Prime-Video Serie „Luden“ spielt in den 80er-Jahren auf der Reeperbahn und zeigt grobe Gewalt gegen Sexarbeiterinnen. Die RTL+-Serie „Die Quellen des Bösen“ hält die Kamera voyeuristisch auf die Opfer eines Ritualmörders in der ostdeutschen Provinz.
Es scheint, als habe sich das Publikum an die Darstellung von Gewalt gewöhnt. Kritik an der Allgegenwart von Gewaltdarstellungen in Deutschland bleibt zumeist aus. Eine Ausnahme: 2022 reichte der gemeinnützige Verein Pro Quote Film, der sich für Gleichberechtigung in der Filmbranche einsetzt, eine Programmbeschwerde gegen die „Tatort“-Episode „Borowski und der Schatten des Mondes“ ein wegen der Gewaltdarstellung gegen Frauen, unter anderem wegen der ständigen Wiederholung einer Vergewaltigungsszene aus Täterperspektive. Im Film geht es um Missbrauch und Mord an jungen Tramperinnen.
Ob im „Tatort“ oder in der True-Crime-Serie, Fernsehen erzählt von Gewalt gegen Frauen fast ausschließlich aus der Täterperspektive. Dabei könnten Gewaltdarstellungen nachvollziehbar machen, was Opfer erleben, ihnen eine Stimme geben, Bewältigungsgeschichten erzählen oder auf strukturelle Probleme aufmerksam machen. Die meisten Produktionen wollen aber weder Debatten auslösen, noch haben sie Platz für die Opferperspektive. Die Studie der MaLisa Stiftung zeigte, dass nur in acht Prozent der Gewaltdarstellungen die Betroffenen ausführlich selbst zu Wort kommen.
Doch es gibt Ausnahmen.
2023 erschienen zwei Produktionen aus Deutschland, die sich jeweils mit einer Vergewaltigung in einer bestehenden beziehungsweise vergangenen Beziehung beschäftigen: die Serie „37 Sekunden“ und der Film „Nichts, was uns passiert“ (beides ARD). In der Serie ist die Tat zu sehen, im Film nur zu hören, weil die Szene im Dunkeln gedreht worden ist. In beiden Produktionen ist die Gewalt nicht oder jedenfalls nicht voyeuristisch ausgestellt, sondern es geht um den Umgang des Opfers und seines jeweiligen Umfelds sowie von Polizei und Justiz damit. In „37 Sekunden“ zum Beispiel ringt die Hauptfigur Leo (gespielt von Paula Kober) auf dem Polizeirevier um die Worte, mit denen sie beschreiben kann, was ihr passiert ist. Am Schluss spricht sie es aus, mehr zu sich selbst als zu den Beamten im Raum: „Er hat mich vergewaltigt.“
„37 Sekunden“ und „Nichts, was uns passiert“ zeigen, dass Gewalt, zum Beispiel die Erfahrung sexueller Gewalt, thematisiert werden muss. Die Frage ist: wie. In beiden Beispielen sind die Frauen Opfer, aber keine Objekte. Sie erheben ihre Stimme und bekommen Raum, mit eigenen Worten zu erzählen, was sie erlebt haben. Die Zuschauer und Zuschauerinnen begleiten sie zur Polizei, teilweise zur gynäkologischen Untersuchung und in den Gerichtssaal. Und die beiden Produktionen machen noch etwas anders als die Klischee-Krimis: Sie thematisieren, dass die meisten Vergewaltigungen im sozialen Umfeld der Opfer verübt werden und nicht von Fremden, die ihren Opfern spätnachts an der Bushaltestelle auflauern und sie überwältigen.
Eine andere Form von geschlechtsspezifischer Gewalt, die viele Filme und Serien zeigen, ist die sogenannte häusliche oder Partnerschaftsgewalt. Man sieht entsprechende Szenen oft in Krimis in Rückblenden, wenn Ermittler oder Ermittlerinnen Morde – Femizide – aufklären. In der ZDF Krimireihe um die Kriminalhauptkommissarin Katharina Tempel erlebt die titelgebende Polizistin Gewalt durch ihren Ehemann. Ungewöhnlich ist, dass der Film hier aus Sicht der Frau erzählt, die zwar Opfer ist, sich aber auch selbst ermächtigt.
Warum gibt es überhaupt so viel Gewalt im Fernsehen? „Beim klassischen Krimi oder Horrorfilm pusht uns der Nervenkitzel und lässt uns den Alltag vergessen“, sagte die Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin Anne Bartsch im August 2019 im Interview mit dem Deutschlandfunk.
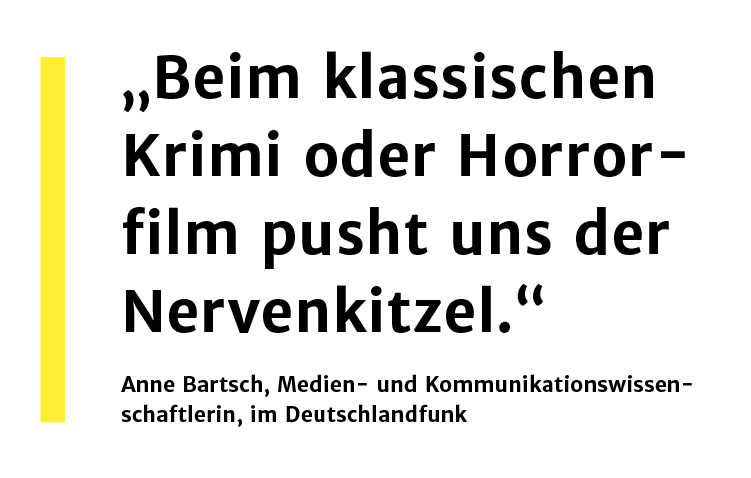
Die Omnipräsenz von Gewalt in Filmen und Serien hat Auswirkungen auf die Gesellschaft und den Blick darauf. Wenn immer wieder reproduziert wird, dass Frauen Opfer von Gewalt werden und Männer Gewalt ausüben, kann das zu einer Desensibilisierung, zu Abstumpfung, zu einer Verinnerlichung von Frauenfeindlichkeit und einer weiteren Verfestigung patriarchaler Strukturen führen. Zuschauer, so Bartsch, könnten durch Gewaltfilme abstumpfen und aggressiver werden. 2013 zeigte außerdem eine Studie, die in der Fachzeitschrift „Psychology of Women Quarterly“ veröffentlicht worden ist, dass Männer, die sexuell objektivierende Medien konsumieren, eher zu sexueller Belästigung und Missbrauch neigen. Bei realistischen Darstellungen von häuslicher Gewalt oder Krieg dagegen, sagt Anne Bartsch, gehe es den Zuschauerinnen und Zuschauern darum, „Gewalttaten oder die Motivation des Täters zu verstehen und moralische Normen zu reflektieren“. In der Regel dient Gewalt der Unterhaltung, für die Spannung, als Schocker – und das ohne Vorabhinweis.
In vielen Ländern sind sogenannte „Triggerwarnungen“ oder Hinweise auf Unterstützungsangebote für Betroffene schon Standard. Im deutschen Fernsehen wird in der Regel ohne Hinweis teilweise explizite Gewalt gezeigt, zeigte die von der MaLisa Stiftung initiierte Studie. In der Psychologie ist der Nutzen von solchen Warnhinweisen zwar umstritten, viele Betroffene schätzen allerdings daran, dass sie dadurch selbst entscheiden können, ob sie gerade mit bestimmten Themen konfrontiert werden möchten. In Deutschland hat jede dritte Frau schon mal körperliche und oder sexualisierte Gewalt erlebt. Zumindest fiktionale Formate könnten sich sehr wohl davon lösen. Im Moment sind das Fernsehprogramm und die Streamingdienste aber nach wie vor voll mit dem ollen Plot: Mann tötet (Ex-) Partnerin oder wahllos Frauen aus Eifersucht, wegen Minderwertigkeitskomplexen oder schlicht aus Hass auf Frauen. Das ist nicht nur höchst problematisch, es ist auch extrem unoriginell.
Kathrin Hollmer





