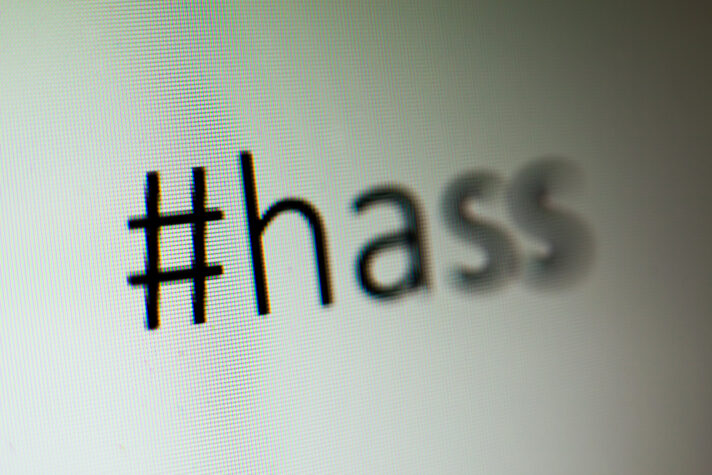Es war Lenny Roths Wahlkampfpremiere. Der heute 22-Jährige kandidierte 2024 bei der Kommunalwahl in Sachsen für die CDU und warb erstmals auf Plakaten für sich und seine Partei. Am 9. Mai ist Roth gerade mit dem Aufhängen beschäftigt, als sich ein Mann vor ihm und einem Unterstützer aufbaut und fragt, ob sie für die AfD plakatieren. Sie verweisen auf die CDU – woraufhin der 31-Jährige noch aggressiver wird. Er nötigt sie, keine weiteren Plakate zu befestigen. Zerstört eines und stößt Roth. Scheucht ihn und dessen Begleiter um das Auto, in dem sie schließlich Schutz finden. Und schlägt noch gegen den Außenspiegel.

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte“, erinnert sich Roth im Gespräch mit der Redaktion des WEISSEN RINGS. Nach „einem Schockmoment“ sei alles relativ schnell gegangen, habe sich aber viel länger angefühlt, „wie in einem Fiebertraum“. Zwei Fragen beschäftigen ihn danach: Was hätte noch alles passieren können? Und: Wieso tue ich mir das eigentlich an? Doch er sagt sich: „Wenn ich aufhöre, tue ich genau das, was solche Leute wollen. Ich darf mich nicht einschüchtern lassen.“ Roth setzt den Wahlkampf fort, berichtet dabei auch von seiner Gewalterfahrung und hat Erfolg. Mit guten Ergebnissen wird er in den Kreistag des Vogtlandkreises und den Stadtrat Auerbach gewählt.
So wie Lenny Roth sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Politikerinnen und Politiker Opfer von Attacken geworden – Tendenz steigend. Wie das Bundesinnenministerium kürzlich auf eine Anfrage der Abgeordneten Martine Renner (Linke) mitteilte, hat die Zahl der Angriffe auf Amts- und Mandatsträger im vergangenen Jahr um 20 Prozent gegenüber 2023 zugenommen, auf 4923 (Stichtag 31. Dezember 2024). Die Zahlen könnten noch steigen, weil die Länder Fälle nachmelden konnten, bei denen beispielsweise Stadtverordnete, Gemeinderatsmitglieder, Landräte oder Bürgermeister das Angriffsziel waren. Bei 99 der erfassten Taten – fünf mehr als im Vorjahr – handelte es sich um Gewaltdelikte, beim Großteil etwa um Sachbeschädigung, Beleidigung oder Propagandadelikte.
Demokratie müsse verteidigt werden
Die meisten Angriffe wurden den Angaben zufolge in Bayern (747), Baden-Württemberg (633), Nordrhein-Westfalen (540) und Berlin (533) verübt, die wenigsten in Bremen (55), Sachsen-Anhalt (105), im Saarland (108) sowie in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern (jeweils 119). In Bayern wurden bereits 2023 die meisten Taten gezählt (864), gefolgt von Baden-Württemberg (494) und Niedersachsen (406).

Auch im aktuellen Wahlkampf kommt es immer wieder zu Vorfällen: So wurde unter anderem im Kreis Herzogtum Lauenburg ein Brandanschlag auf einen Bus der SPD verübt, in Bautzen einem Mitglied der Linken ins Gesicht geschlagen. Und an einem FDP-Bus im Taunus haben Unbekannte Radmuttern gelockert.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte der Redaktion des WEISSEN RINGS: „Die Verteidigung unserer Demokratie beginnt mit dem Schutz derer, die Tag für Tag für sie eintreten. Wir erleben immer stärkere Bedrohungen, Einschüchterungsversuche und Übergriffe.“ Um unmissverständlich zu zeigen, dass der Rechtsstaat das nicht hinnehme, gehe das Bundeskriminalamt massiv gegen Hasskriminalität vor, weil diese den Nährboden für Gewalttaten bereite. Vielerorts seien polizeiliche Schutzkonzepte hochgefahren, Streifen verstärkt und feste Ansprechstellen für Betroffene geschaffen worden. Und Anfang August 2024 habe die „Starke Stelle“, die bundesweite Ansprechstelle zum Schutz von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern, ihre Arbeit aufgenommen, womit auch der Bund einen wichtigen Beitrag leiste.
Darüber hinaus, so die Bundesinnenministerin, brauche es „ein deutliches Stopp-Signal gegen Bedrohungen und Gewalt für die Täter: durch schnelle und spürbare Strafen. Damit sie nicht den Mut verlieren, müssen die Betroffenen sehen, dass ihre Strafanzeigen Folgen haben und die Täter ermittelt werden.“
Zuletzt waren die Grünen am häufigsten Opfer: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 2024 gegen Abgeordnete, Mitglieder und Mitarbeiter der Grünen rund 1190 polizeilich erfasste Straftaten verübt. Danach folgten die AfD (1030), SPD (780), CDU (420), FDP (320) und Linke (130).

Anfang dieses Jahres hat die „Starke Stelle“ eine erste Bilanz ihrer Arbeit vorgestellt. Bis dahin hat sie nach eigenen Angaben mehr als 120 Anfragen bearbeitet – die die Betroffenen oft erst nach einem längeren „Leidensweg“ gestellt hätten. Zumeist sei es um verbale oder schriftliche Anfeindungen, Verleumdungen, Beleidigungen oder Bedrohungen gegangen, die zum Teil aus den jeweiligen kommunalen Gremien kamen. Auffällig: Darunter waren eine ganze Reihe von „Doxing“-Fällen. Dabei werden persönliche Daten von Betroffenen gegen deren Willen öffentlich gemacht, oft, um sie einzuschüchtern.
Heftige Beleidigungen im Internet
Am Demokratiezentrum, das an der Philipps-Universität Marburg angesiedelt ist, promoviert Nora Zado über Bedrohungen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Hessen. 20 Betroffene hat die empirische Kulturwissenschaftlerin intensiv befragt. Die Studie soll bald veröffentlicht werden. Mit der Redaktion des WEISSEN RINGS sprach sie vorab über ihre wesentlichen Erkenntnisse.
Der aktuelle Anstieg bei den Angriffen, sagt Zado, resultiere zum einen daraus, dass sich das Problem zuspitze: Immer mehr Menschen glaubten, sie müssten sich gerade im Netz nicht an Gesetze halten. „Teilweise werden heftige Beleidigungen mit Klarnamen gepostet.“ Zum anderen „verstehen Betroffene zunehmend: Die Attacken sind nicht Teil ihres Amtes, und es ist wichtig, Anzeige zu erstatten – auch um demokratische Werte zu verteidigen.“
Die Angriffe gegen die kommunalen Amts- und Mandatsträger kommen aus verschiedenen Richtungen, hat Zado herausgefunden: von sogenannten Reichsbürgern und anderen Rechtsextremen. Von unzufriedenen Bürgern und Initiativen, die sich keinem politischen Spektrum zuordnen ließen. Und auch von anderen Amts- und Mandatsträgern. Der Ton untereinander sei manchmal heftig. Teilweise verstünden die Täter gar nicht, was sie falsch gemacht haben, andere hingegen wüssten es sehr wohl, gingen methodisch vor. Wieder andere seien psychisch auffällig.
Die Kulturwissenschaftlerin sieht einen gesellschaftlichen Wandel, bei dem die Streitkultur und der Respekt für Ämter verloren gegangen seien: „Es gibt immer mehr ,Ichlinge‘, die besonders die Kommunalpolitik als Dienstleister betrachten, der alles sofort für sie tun muss. Wenn nicht, werden sie aggressiv“, erklärt Zado. Die Folgen? Die von Zado Befragten trotzten den Angriffen, ließen sich bei ihrer Arbeit nicht davon beeinflussen. Aber ihre Lebensqualität leide. „Und wir stellen fest, dass Parteien immer mehr Probleme haben, Kandidaten zu finden.“
Pflastersteine zerstörten Partei-Büro
Zu den Betroffenen des vergangenen Jahres zählen auch die Münchner Grünen. Die Scheiben ihres Büros am Nordbad wurden in der Nacht auf den 1. November 2024, gegen 23.20 Uhr, mit einer ganzen Ladung Pflastersteinen zerstört. Als Svenja Jarchow, Vorsitzende des Kreisverbandes München, davon erfährt, ist sie schockiert: „Alles war zersplittert, obwohl die Scheiben dick waren. Meine erste Sorge damals: War noch jemand drin?“ Glücklicherweise nicht. Dann habe sie darüber nachgedacht, was jetzt zu tun sei, wie sich das Risiko verringern und der Schutz verbessern lasse, blickt Jarchow zurück. „Es war eine geplante Aktion. Die Steine lagen nicht in der Gegend herum.“ Die Partei hat eine „Handreichung“ für ihre Mitglieder zusammengestellt, mit Informationen zu Anlaufstellen und Hinweisen wie jenem, nicht alleine im Wahlkampf unterwegs zu sein.

Es war nicht der erste Angriff auf die Münchner Grünen. Einmal wurde Kleister in ein Schloss gefüllt. Eine Parteikollegin Jarchows, die im Landtagswahlkampf plakatierte, wurde erst rassistisch beleidigt, dann mit einer Flüssigkeit bespritzt, die sich zur Erleichterung der Grünen als harmlos herausstellte. Ein anderes Mal wurde ein Infostand zusammengetreten.
„Die Stimmung ist sehr aufgeheizt, es hat sich etwas verschoben bei der Frage: Wie kann ich mit anderen umgehen?“, sagt Jarchow. Die Grünen würden immer wieder mal als Schuldige in den Vordergrund geschoben, als Feindbild „markiert“. Es treffe aber auch andere Parteien. Die Kreisverbandsvorsitzende kritisiert einen grundsätzlichen Mangel an Respekt, der sich auch in den vielen verbalen Attacken im Netz spiegele. „Wofür machen wir das? Ist es das wert?“ Auch Jarchow hat sich diese Fragen schon gestellt. Sie konzentriere sich dann auf die positiven Erfahrungen und die Solidarität: „Unsere Mitglieder sagen: Wir weichen nicht, sondern halten zusammen. Nachbarn haben nach dem Anschlag auf unser Büro schnell die Polizei gerufen und standen an unserer Seite.“
Zu den zahlreichen Angriffen in Bayern teilt das dortige Innenministerium auf Anfrage der Redaktion des WEISSEN RINGS mit, „abschließende und valide Zahlen“ für 2024 lägen voraussichtlich Anfang des zweiten Quartals vor. Das Ministerium bestätigt aber, dass es in den vergangenen Jahren einen Anstieg der Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger gab. Die Corona-Pandemie und auch vergangene Wahlen hätten dies begünstigt. Hinzu komme, dass Bayern zu den bevölkerungsstärksten Ländern zähle. Die Aufklärungsquote sei ebenfalls gestiegen, auf 70 Prozent, weshalb das Ministerium an Betroffene appelliere, immer Anzeige zu erstatten. Außerdem verweist es auf ein 2020 aufgebautes Schutzkonzept mit Präventionsveranstaltungen und Sicherheitsberatung der Kriminalpolizei.
Das bayerische Justizministerium nennt auf Anfrage spezielle Ansprechpartner bei den Staatsanwaltschaften sowie ein vereinfachtes Online-Verfahren für Kommunalpolitiker und Abgeordnete bei Straftaten im Netz. Die bayerische Staatsregierung „nimmt diese Attacken auf unseren Rechtsstaat und seine demokratischen Repräsentanten nicht hin“, sagt Justizminister Georg Eisenreich (CSU). „Der Fall Walter Lübcke und die aktuellen Fälle zeigen: Aus Worten können auch Taten werden.“ Lübcke wurde 2019 von einem Rechtsextremisten ermordet. Zuvor war er im Netz aufgrund seines Einsatzes für Geflüchtete zum Feindbild erklärt worden.
Nach Ansicht des Ministeriums bildet das Strafrecht die derzeitige Bedrohung für Mandatsträger, aber auch für Ehrenamtliche nicht angemessen ab. Bayern habe sich deshalb schon 2023 für eine Strafschärfung im Bundesrat eingesetzt, um vor allem gegen Körperverletzung und Nötigung härter vorgehen zu können.
Politikwissenschaftler Andreas Blätte von der Universität Duisburg-Essen und sein Team haben bereits 2022 eine umfangreiche Studie zum Thema veröffentlicht, für die sie Amts- und Mandatsträger in Großstädten befragt hatten. Der Titel: „Vielfältige Repräsentation unter Druck: Anfeindungen und Aggressionen in der Kommunalpolitik“. Zur derzeitigen Entwicklung sagt Blätte: „Konflikte werden zunehmend im Freund-Feind-Modus ausgetragen. Gerade in den sozialen Medien, die Treiber dieser Entwicklung sind, ,radikalisieren‘ sich Menschen und fühlen sich zu verbalen oder sogar tätlichen Angriffen ermächtigt.“
Die Gesellschaft, erklärt Blätte, „steht unter Stress. Es gibt viele Hinweise darauf, dass Menschen dünnhäutiger sind, eine kürzere Zündschnur haben, auch aufgrund einer durch Corona, Klimawandel und andere Faktoren ausgelösten Veränderungserschöpfung.“ Gemütslagen schaukelten sich schnell hoch. Die Eskalationsspirale lasse sich nur beenden, wenn die Ächtung von Gewalt in politischen Debatten wieder Konsens werde. Ein wichtiger Befund von Blättes Studie war, dass Vertreter aller Parteien von den Attacken betroffen sind. Die Intensität hänge davon ab, inwieweit eine Partei zum politischen Feindbild stilisiert worden ist, sagt der Professor. Täter fühlten sich dadurch ermächtigt, beispielsweise Hassmails zu schreiben.
Viele Amts- und Mandatsträger seien resilient, trotzten den Angriffen, sagt Andreas Blätte, obwohl sie im Kern mit einer terroristischen Strategie konfrontiert seien: Es handele sich um Signaltaten, die auch nicht-unmittelbar Betroffene treffen sollen. Manche zermürbe der Hass; sie fühlten sich alleingelassen.
„Die Parteien merken, was ihr Personal durchmacht, es gibt Notfallmechanismen und Sicherheitsmaßnahmen, gerade in Wahlkampfzeiten“, so Blätte. Besonders auf kommunaler Ebene müssten die Probleme noch ernster genommen werden, damit „das Fundament der Demokratie nicht erodiert“. Dort seien die Betroffenen schon aufgrund der Nähe exponierter und weniger geschützt.
Zudem spricht sich Blätte für einen verstärkten Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Amts- und Mandatsträgerinnen aus. Die zahlreichen, massiv belastenden Fälle würden seltener angezeigt. „Es fehlt an spezialisierten Hilfsangeboten.“
Es brauche mehr Personal und Eingriffsmöglichkeiten
In den vergangenen Jahren sei die Hilfe für Betroffene insgesamt durchaus verbessert worden, zum Beispiel durch mehr Melde- und Beratungsstellen, sagt Kulturwissenschaftlerin Nora Zado. Die Sicherheits- und Justizbehörden nähmen das Problem ernst. Es gebe aber noch Verbesserungsbedarf. So bräuchten insbesondere ehrenamtliche Amts- und Mandatsträger mehr juristische Unterstützung, Polizei sowie Staatsanwaltschaft wiederum mehr Personal und schnellere Eingriffsmöglichkeiten für solche Fälle. Im Rahmen ihrer Forschungsarbeit erfuhr Zado, dass manche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister regionale informelle Netzwerke parteiübergreifend bilden, um sich auszutauschen und Tipps zu geben. Eine Art Selbsthilfegruppe, in der sie sich gegenseitig stärken.

Svenja Jarchow hält gegenseitige Unterstützung – auch über Parteigrenzen hinweg – ebenfalls für wertvoll. Polizei und Staatsanwaltschaft seien mittlerweile sensibilisiert für die Problematik, kümmerten sich darum. „Es ist entscheidend, die Vorfälle zur Anzeige zu bringen, auch für die Statistik. Erst dann wird das Ausmaß klar“, so Jarchow. Um Betroffenen besser zu helfen, brauche es schnellere Verfahren und ein engmaschigeres Netz an Beratungsstellen. Hier sei Bayern nicht optimal aufgestellt.
Der Angreifer von Lenny Roth ist im Januar unter anderem wegen Nötigung in Tateinheit mit Sachbeschädigung verurteilt worden. Die viermonatige Haftstrafe resultiert auch aus früheren Taten und Vorstrafen. „Das Einzige, was abschreckt, sind Strafen“, sagt Roth. Es brauche Konsequenz – und ein Umdenken: Der Nachwuchspolitiker beobachtet eine zunehmende Verrohung und „zu viel Schwarz und Weiß, zu wenig Grautöne, vor allem in sozialen Medien“. Gleichzeitig müssten Leute, die eine Meinung hätten, Gegenmeinungen aushalten.
Roth betont, er werde sich auch künftig nicht verunsichern lassen: „Mein Wille, etwas zu bewegen, gibt mir Kraft.“
Text: Gregor Haschnik