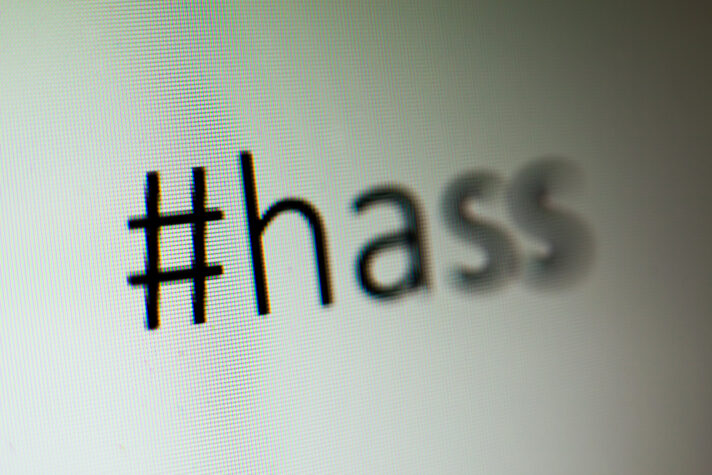Frau Ministerin Lambrecht, sind Sie jemals Opfer einer Straftat geworden?
So wie viele Politikerinnen, die sich gegen rechtsextreme Hetze und Gewalt engagieren, bekomme ich regelmäßig üble Drohungen. Diese sind oft voller Hass auf Frauen oder auf die Demokratie. Solche Drohungen bringe ich konsequent zur Anzeige. Aber als Politikerin kann ich damit leichter umgehen als Menschen, für die Hass-Attacken im Netz und auf der Straße bitterer Alltag geworden sind. Für diese Menschen müssen wir da sein und sehr viel entschiedener als früher gegen Hass und Hetze vorgehen.
Als Justizministerin sind Sie von Amts wegen vor allem für Täter zuständig. Stimmen Sie uns zu?
Nein, und das wäre auch ein völlig falsches Amtsverständnis. Richtig ist, dass die Täter oft die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber unsere Unterstützung und Solidarität gilt den Opfern von Straftaten. Mein Haus ist für die Strafprozessordnung zuständig. Darin haben die Rechte der Verletzten von Straftaten zentrale Bedeutung. Diese Rechte haben wir in den letzten Jahren immer weiter gestärkt. Erst vor wenigen Tagen habe ich einen Gesetzentwurf vorgelegt, um Zeugen besser vor Bedrohungen zu schützen. Genauso wichtig ist: Nur wer seine Rechte kennt, kann sie nutzen. Deshalb haben wir mit hilfe-info.de jetzt eine Online-Plattform mit wichtigen Infos, Ansprechpartnern und Unterstützungsangeboten vor Ort gestartet.
Aber die Strafverfolgung, das Strafrecht und auch die Strafprozessordnung stellen doch nach wie vor die Verursacher von Kriminalität in den Mittelpunkt, nicht die Betroffenen. Ganz konkret: Kommen die Opfer zu kurz im deutschen Recht?
Es ist in der Tat so, dass Verletzte schwerer Straftaten lange Zeit im Strafverfahren vor allem „Beweismittel“ waren. Es dauerte lange, bis man erkannte, dass es hier um Menschen mit traumatischen Erfahrungen, mit Schicksalen und Gefühlen geht, die unsere Unterstützung dringend benötigen. Ein Strafprozess ist eine Ausnahmesituation für die Betroffenen. Dass dieser Perspektivwechsel stattgefunden hat, ist auch dem Engagement des WEISSEN RINGS und vieler weiterer Opferhilfeeinrichtungen zu verdanken. Erst im vergangenen Jahr haben wir im Bundestag das Opferentschädigungsrecht grundlegend reformiert. Betroffene von Gewalttaten haben ab dem nächsten Jahr einen Anspruch auf Hilfe in Trauma-Ambulanzen, die in ganz Deutschland zügige psychologische Hilfen anbieten.
Werden ab dem 1. Januar 2021 tatsächlich flächendeckend Trauma-Ambulanzen eingerichtet sein? Also auch in ländlichen Regionen? Denn das Thema ist ja Ländersache. Was kann denn der Bund dafür tun, wie wollen Sie das sicherstellen?
Nahezu alle Bundesländer verfügen bereits über Trauma-Ambulanzen. Ab 2021 liegt es jedoch nicht mehr im Ermessen der Länder, ob sie Zugang zu den Trauma-Ambulanzen gewähren. Denn der Bund hat mit der Reform des Sozialen Entschädigungsrechts einen einklagbaren Anspruch von Betroffenen auf Leistungen der Trauma-Ambulanz geschaffen. Es besteht auch ein Anspruch auf Übernahme der erforderlichen Fahrtkosten zur nächstgelegenen Ambulanz. Der Bund wird zudem bundeseinheitliche Qualitätsstandards in einer Verordnung festlegen, da geht es zum Beispiel um die Erreichbarkeit der Trauma-Ambulanzen.
„Ich hab größte Hochachtung vor Menschen, die sich ehrenamtlich für Betroffene von Straftaten einsetzen. Ein großer Dank an sie alle!“
– Christine Lambrecht
Beim WEISSEN RING bewerben sich immer wieder ehemalige Polizisten oder Staatsanwälte als ehrenamtliche Mitarbeiter. Ihre Motivation begründen sie damit, dass sie sich im Berufsleben nicht hinreichend um die Opfer hätten kümmern können. Was sagen Sie denen?
Ich habe größte Hochachtung vor Menschen, die sich ehrenamtlich für Betroffene von Straftaten einsetzen. Ein großer Dank an sie alle! Die tägliche Arbeit der Polizistinnen und Polizisten sowie der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte lässt die Betreuung der Opfer nicht immer so zu, wie es wünschenswert wäre. Das hat auch mit der hohen Arbeitsbelastung zu tun. Oftmals kann man allerdings schon mit geringem Aufwand Betroffene wirksam unterstützen, indem man sie gezielt auf ihre Rechte und Unterstützungsangebote aufmerksam macht. Dazu gehören Opferhilfeeinrichtungen und die Trauma-Ambulanzen.
Ein aktuelles Beispiel: Sie haben den Fonds für die Opfer des rechtsextremistischen Oktoberfest-Attentats als „wichtiges Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen“ bezeichnet. Warum dauerte es 40 Jahre, bis es dieses Zeichen gab?
Der Generalbundesanwalt hat in diesem Sommer die Ermittlungen abgeschlossen, nachdem sie vor einigen Jahren wiederaufgenommen worden waren. 40 Jahre nach der Tat gibt es nun endlich die klare Feststellung: Das Oktoberfest-Attentat war ein rechtsextremistischer Terroranschlag, der schwerste der deutschen Nachkriegszeit. Bei vielen Betroffenen wirken die Erinnerungen und Verletzungen dieses schrecklichen Anschlags bis heute nach. Der Bund, der Freistaat Bayern und die Stadt München haben sich nun entschlossen, mit dem Fonds in Höhe von 1,2 Millionen Euro ein weiteres Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen zu setzen. Uns ist sehr bewusst, dass diese Hilfe sehr, sehr spät kommt. Umso wichtiger ist es, dass es sie jetzt geben wird.

Ein anderes aktuelles Thema ist die sexuelle Gewalt gegen Kinder. Nach den Schlagzeilen zu Lügde, Münster oder Bergisch Gladbach richtete sich auch hier Ihr Blick auf die Täter: Sie brachten Strafverschärfungen auf den Weg. Glauben Sie tatsächlich, Sie können damit Missbrauchstaten verhindern?
Um Kinder vor diesen entsetzlichen Verbrechen zu schützen, haben wir ein umfassendes Paket beschlossen. Dazu gehören deutlich schärfere Strafen und eine effektivere Strafverfolgung. Diese Maßnahmen greifen ineinander. Täter fürchten nichts mehr, als entdeckt zu werden. Den Verfolgungsdruck müssen wir deshalb massiv erhöhen. Dazu dienen auch die Strafschärfungen, die Verfahrenseinstellungen künftig ausschließen. Der Gesetzentwurf enthält aber auch wichtige Maßnahmen im präventiven Bereich. Wir werden besondere Qualifikationsanforderungen für Familienrichterinnen und Familienrichter, Jugendrichterinnen und Jugendrichter, Jugendstaatsanwältinnen und Jugendstaatsanwälte sowie Verfahrensbeistände gesetzlich verankern. Wir werden auch sicherstellen, dass Kinder unter 14 Jahren vom Gericht grundsätzlich persönlich angehört werden und sich das Gericht einen persönlichen Eindruck vom Kind verschafft.
Ein Hauptproblem bleibt doch: Ein Kind muss sich im Durchschnitt sieben Mal an einen Erwachsenen wenden, bis ihm jemand zuhört und glaubt. Was kann eine Bundesjustizministerin dafür tun, dass Kindern mehr Gehör geschenkt wird?
Wir brauchen höchste Wachsamkeit und Sensibilität für Kinder, die gefährdet sind oder bereits Opfer von sexualisierter Gewalt wurden. Hier ist jeder und jede gefordert. Mein Gesetzespaket ist ein wichtiger Schritt, um Personen, die Umgang mit Kindern haben, wachzurütteln. Jugendämter, Schulen, Kindergärten oder Sportvereine müssen Kinder ernst nehmen und sensibel auf auffällige Wesensänderungen von Kindern reagieren.

Sexuelle Gewalt gegen Kinder soll künftig nicht als Vergehen, sondern als Verbrechen geahndet werden. Das hat Folgen für die kindlichen Opfer, die möglicherweise häufiger vor Gericht als Zeugen aussagen müssen. Wie wollen Sie diese Kinder vor Retraumatisierung schützen?
Wiederholte Vernehmungen machen es Kindern noch schwerer, das Entsetzliche, das sie erleben mussten, zu verarbeiten. Deswegen haben wir es Ende 2019 zur gesetzlichen Regel gemacht, dass die Vernehmung von allen Opfern von Sexualstraftaten und damit auch und gerade von minderjährigen Opfern bereits im Ermittlungsverfahren durch eine Richterin oder einen Richter erfolgt. Diese Vernehmung wird auf Video aufgezeichnet. Die Aussage kann später in der Hauptverhandlung verwertet werden. So können Mehrfachvernehmungen vermieden werden.
Laut Koalitionsvertrag sollten die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden. Mit einem Passus, demzufolge das Wohl des Kindes „bei allem staatlichen Handeln, das es unmittelbar in seinen Rechten betrifft, angemessen zu berücksichtigen“ ist. 2019 sagten Sie, das könne bis Ende 2020 geschehen sein. Inzwischen liegt das Projekt auf Eis. Schaffen Sie das noch bis zur nächsten Bundestagswahl?
Wer es mit dem Schutz von Kindern ernst meint, muss die Kinderrechte im Grundgesetz verankern. Bei jedem staatlichen Handeln muss das Kindeswohl im Blick sein. Jedem Kind muss zugehört werden. Das würden die Kinderrechte im Grundgesetz verdeutlichen. Über die Grundzüge haben wir uns in der Bundesregierung geeinigt. Jetzt muss die Union endlich den Weg dafür freimachen, dass Bundestag und Bundesrat über die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz beraten können.
Halle, Hanau, der Fall Lübcke, zuletzt ein antisemitischer Angriff in Hamburg: Wir haben es zunehmend mit Gewalttaten zu tun, deren Täter sich zuvor im Internet radikalisiert haben, aufgestachelt durch Hass und Hetze sowie Verschwörungsmythen. Hat der Staat diese Gefahrenquelle zu lange übersehen?
Die Radikalisierung, die wir im Netz erleben, ist schlimmer geworden. Es gibt eine Spirale von Drohungen, die bis hin zu dem rechtsextremistischen Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke geführt haben. Auch die Corona-Krise spült einmal mehr Wellen von Hass und kruden Verschwörungserzählungen ins Netz, ein großer Teil davon ist rassistisch oder antisemitisch. Damit beschäftigen wir uns sehr intensiv. 2017 gehörten wir zu den Ersten in Europa, die strikte Zeitvorgaben für soziale Netzwerke gesetzlich verankert haben. Offensichtlich strafbare Postings müssen innerhalb von 24 Stunden nach einem Hinweis gelöscht werden. Mit unserem Gesetzespaket gegen Hass und Hetze gehen wir noch deutlich weiter. Schwere Fälle von Hasskriminalität müssen künftig dem Bundeskriminalamt gemeldet werden. Diese Fälle müssen endlich konsequent vor Gericht landen.

Ihr Gesetz gegen Hasskriminalität haben Sie selbst „von zentraler Bedeutung für die Verteidigung unserer Demokratie“ genannt. Aktuell steht es aus verfassungsrechtlichen Gründen auf wackligen Füßen, der Bundespräsident hat noch nicht unterschrieben. Was machen Sie, wenn die Unterschrift weiter ausbleibt?
Das Bundesverfassungsgericht hat einen Monat nach dem Beschluss des Gesetzes im Bundestag eine Entscheidung veröffentlicht, die einzelne Bestimmungen des Gesetzes berührt. Die Bundesregierung arbeitet deshalb jetzt mit Hochdruck daran, die jüngsten Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts unter anderem zu den Befugnissen des Bundeskriminalamts umzusetzen.
Also haben Sie keinen Zweifel, dass das Gesetz zeitnah kommen wird?
Das hat höchste Priorität. Das weiß auch mein Kollege Horst Seehofer, dessen Ministerium die wesentlichen Änderungen auf den Weg bringen muss.
Mit diesem Gesetz gegen Hasskriminalität nehmen Sie vor allem die Betreiber der Internetseiten in die Pflicht, die Hass und Hetze zulassen. Woher nehmen Sie den Optimismus, dass ausgerechnet diejenigen, die seit Jahren keinerlei Verantwortungsbewusstsein zeigen, dem Treiben ein Ende setzen werden?
YouTube, Facebook und Co sind in der Verantwortung, sich nicht als Hetz-Plattformen missbrauchen zu lassen. Die Plattformen haben eine Verantwortung, der sie endlich gerecht werden müssen. Wenn sich immer mehr Menschen aus den Diskussionen in sozialen Netzwerken zurückziehen, weil sie keine Lust mehr haben auf Hass und Hetze, dann schadet das auch dem Geschäft der Plattformen. Daher passiert dort auch endlich etwas. Doch das reicht noch nicht. Auf europäischer Ebene beraten wir weitere Schritte. Die Betreiber müssen endlich ganz klar gegen Rassismus, Frauenhass, Muslim- oder Judenfeindlichkeit auf ihren Plattformen vorgehen. Genauso wie gegen Verschwörungsmythen, die gerade in der Corona- Zeit Leben und Gesundheit von Menschen gefährden können.
Verlagern Sie nicht einfach Verantwortung? Wäre es nicht Aufgabe des Staates, mit eigenen Ermittlungsgruppen das Netz zu durchforsten, um Straftaten aufzudecken und anzuklagen?
Durch die Meldepflicht der sozialen Netzwerke bei Volksverhetzungen oder Morddrohungen wird es zu sehr viel mehr Ermittlungsverfahren kommen. Das BKA gibt die Fälle an die zuständigen Staatsanwaltschaften ab, die können konsequent ermitteln und anklagen.
„Recht und Gesetz gelten im Internet genauso wie im analogen Leben. Wir müssen das Recht aber viel stärker als früher auch im Netz durchsetzen.“
– Christine Lambrecht
Das Internet entpuppt sich immer wieder als ein weitgehend verfolgungsfreier Raum. Sehen Sie überhaupt eine Chance, dessen Herr zu werden?
Recht und Gesetz gelten im Internet genauso wie im analogen Leben. Wir müssen das Recht aber viel stärker als früher auch im Netz durchsetzen. Dafür hat die Justiz zahlreiche Ermittlungsinstrumente wie etwa Onlinedurchsuchungen, die wir ermöglicht haben. Ich werde in Kürze einen Gesetzentwurf vorlegen, der auch das Problem illegaler Plattformen im Internet, auf denen etwa Kinderpornografie, Drogen oder Waffen gehandelt werden, angeht.
Beispiel Kinderpornografie und Kindesmissbrauch: Im Ermittlungskomplex Bergisch Gladbach gibt es Tausende Verdächtige, bislang aber nur vereinzelte Anklagen. Ist die Justiz chancenlos gegen die digitale Kriminalität?
Die intensiven Ermittlungen zeigen, dass die Justiz diese schrecklichen Taten aufklären und die Täter überführen kann. Die Anwendbarkeit der Ermittlungsinstrumente weiten wir mit dem Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder weiter aus. Gleichzeitig erleichtern wir die Verhängung von U-Haft in diesen Fällen. Wir verdoppeln die Fristen, in denen Taten in das Führungszeugnis aufgenommen werden – auf 20 Jahre nach Verbüßung der Freiheitsstrafe. Zugleich schaffen wir ein besonderes Beschleunigungsgebot: Im Interesse der Kinder müssen die Strafverfahren mit besonderer Priorität geführt werden.
Besteht überhaupt so etwas wie Waffengleichheit? Gerade hat sich der EuGH abermals gegen die Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen, die Ermittler für ein wichtiges Mittel im Kampf gegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch halten. Wie sehen Sie das?
Wenn der Europäische Gerichtshof die deutschen Regelungen bestätigt, können wir die Vorratsdatenspeicherung in diesem Bereich einsetzen. Die Vorratsdatenspeicherung ist eines, aber nicht das einzige Mittel zur Bekämpfung der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und der Kinderpornografie. Die Ermittlungserfolge der letzten Zeit zeigen, dass effektiv und konsequent ermittelt wird.
Auf der einen Seite steht der Datenschutz gegen diese Möglichkeit der Verbrechensbekämpfung. Auf der anderen Seite teilen Menschen freiwillig Millionen persönliche Daten in den sozialen Netzwerken, sammeln Internetkonzerne und andere Unternehmen alles an Daten, werden wir mit personalisierter Werbung zugespamt. Passen unsere Datenschutzgesetze noch zur gesellschaftlichen Wirklichkeit?
Der Datenschutz hindert nicht die Verfolgung schwerer Straftaten. Hierfür enthält die Strafprozessordnung scharfe Eingriffs- und Überwachungsbefugnisse, die Gerichte anordnen können. Für alle anderen Bereiche gilt: Der Schutz der Privatsphäre ist in der digitalen Welt besonders wichtig. Wir wollen keine gläsernen Menschen, die mit jedem Klick noch mehr über sich preisgeben. Bürgerinnen und Bürger sollen selbst entscheiden können, welche persönlichen Daten von ihnen verwendet werden dürfen. Datenschutz ist ein Grundrecht – und Voraussetzung für Vertrauen in digitale Dienste. Hier bleibt bei vielen Anbietern viel zu tun. Wie es geht, haben wir mit der Corona-Warn-App gezeigt. Die App hilft, Infektionsketten zu durchbrechen, wird inzwischen von über 20 Millionen Bürgerinnen und Bürgern genutzt und schützt dabei strikt die Privatsphäre.
Tobias Großekemper und Karsten Krogmann
Christine Lambrecht, 1965 in Mannheim geboren, ist seit 1982 Mitglied der SPD. Seit dem 27. Juni 2019 ist sie Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz. Im Interview mit dem WEISSEN RING spricht sie unter anderem über sexuelle Gewalt gegen Kinder, die mögliche Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz und zunehmende Hasskriminalität im Netz.
Lambrecht war 1998 zum ersten Mal für den Wahlkreis Bergstraße als Abgeordnete in den Bundestag gewählt worden. Im September 2020 teilte ihr Wahlkreis mit, dass sie bei der Bundestagswahl 2021 nicht mehr antreten werde. In einem Schreiben an die SPD-Mitglieder der Region habe Lambrecht deutlich gemacht, „dass Politik als Beruf nur auf Zeit ausgeübt werden sollte“, hieß es damals.