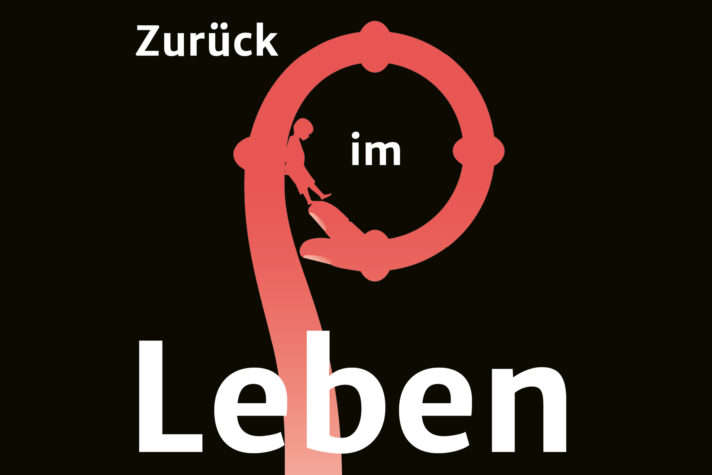Journalistinnen und Journalisten berichten über Anfeindungen, Bedrohungen und Gewalt in ihrem Berufsalltag. Wie ist die Lage?
Zwar haben die körperlichen Angriffe aktuell aufgrund des nachlassenden Demo-Geschehens zuletzt wieder abgenommen, aber es gibt sie weiterhin. Zuvor ging der starke Anstieg von Attacken auf Journalistinnen und Journalisten zum ganz überwiegenden Teil auf das Konto der Corona-Proteste. Die meisten Angriffe kommen derzeit von rechts, wobei es aber auch Behinderungen von Pressearbeit bei Umwelt-Protesten und vereinzelt auch bei linken Demos gibt.

Hass gibt es ja nicht nur auf der Straße, sondern auch digital. Welchen Angriffen sind Medienschaffende konkret ausgesetzt?
Sie erleben das ganze Spektrum von Beleidigungen bis zu regelrechten Treibjagden, wenn die private Anschrift veröffentlicht wird oder der Beziehungsstatus. Auf der Straße wird geschubst und geschlagen, auf den sozialen Plattformen wird versucht, Kolleginnen rauszudrängen und sie mundtot zu machen, indem Drohungen gegen die Familie und das private Umfeld ausgesprochen werden. Social Media ist für Freischaffende ja ein ganz wichtiger Vertriebskanal. Angriffe, die zum Rückzug aus der Öffentlichkeit führen, bedrohen also Existenzen.
Was macht das mit den Betroffenen?
Ich kenne Fälle, da mussten bedrohte Personen den Wohnort wechseln. Andere mussten die Hilfe von Psychotherapeuten in Anspruch nehmen. Obwohl die Quantität der Angriffe derzeit aufgrund der abflauenden Corona-Proteste abgenommen hat, ist die Qualität der Angriffe weiterhin hoch. Bis heute gibt es im Berufsalltag etlicher Kolleginnen und Kollegen körperliche Gewalt und Morddrohungen.
Wie reagieren die Journalistinnen und Journalisten, aber auch die Redaktionen darauf?
Für die Redaktionen verursacht die Bedrohungslage hohe Zusatzkosten. Viele schicken ihre Dreh-Teams nur noch mit Security raus, das kostet Geld. Eine Folge der unheilvollen Entwicklung ist, dass bei bestimmten Demos kaum noch Interviews möglich sind. Unser Handwerk verändert sich also grundlegend. Das Ergebnis ist eine eingeschränkte Berichterstattung. Besonders schwierig ist die Situation übrigens für die Freien, die keine Anbindung an eine Redaktion haben. Viele überlegen sich ganz genau, ob sie das Risiko eingehen wollen, geschlagen zu werden oder mit einer beschädigten Ausrüstung zurückzukommen. Einige ändern von Demo zu Demo ihren Kleidungsstil, um nicht erkannt zu werden. Mittlerweile spricht man untereinander ganz offen über vorhandene Ängste.
Seit Jahren fordern Betroffene und Verbände einen besseren Schutz für Journalistinnen und Journalisten, aber die Angriffe hören nicht auf. Warum?
Es ist nicht so, dass es keine Fortschritte gibt. Mittlerweile trauen sich die Redaktionen, über Gewalt gegen die eigenen Leute zu berichten. Das war lange Zeit nicht der Fall. Auch die Polizei hat mittlerweile verstanden, dass es ein ernstes Problem gibt. Die Gesprächskultur zwischen Presse und Polizei hat sich seither deutlich verbessert. Es bewegt sich also durchaus etwas, aber das reicht noch nicht aus. Wichtig ist, die Methoden und Taktiken, die Presse besser als bisher zu schützen, bundesweit weiterzuentwickeln und vor allem flächendeckend anzuwenden. Wir brauchen dringend ein standardisiertes Vorgehen. Niedrigschwelliges Eingreifen bei Übergriffen auf Demos muss überall zur Routine werden, wie das in Berlin schon der Fall ist. Dafür muss man das Versammlungsrecht ausschöpfen und die notwendigen Instrumente bereitstellen. Von einer solchen Praxis, auf die sich die Kolleginnen und Kollegen auf der Straße jederzeit verlassen können, sind wir derzeit noch weit entfernt.
Woran liegt das und wer ist gefragt, das zu ändern?
Seit Beginn der Pandemie und entsprechender Demos gab es eine unheimliche Enthemmung und Entgrenzung auf den Straßen. Mittlerweile hat die Polizei anerkannt, dass Fehler gemacht wurden und freie Berichterstattung in Gefahr ist. Aber noch fehlt es an dem festen politischen Willen, daraus Konsequenzen zu ziehen und besseren Schutz verbindlich zu organisieren. Man muss es so drastisch sagen: In den vergangenen beiden Jahren hat es hierzulande zwar keine getöteten Journalisten gegeben, aber das hätte passieren können. Einige Betroffene haben einfach nur Glück gehabt.
Michael Kraske
Das fordert der WEISSE RING:
Die Gesetzgeber müssen die Vorgaben zum Schutz der Presse im Versammlungsrecht eindeutig festschreiben. Angriffe auf Reporterinnen und Reporter sowie Behinderungen von deren Arbeit müssen von der Polizei konsequent und flächendeckend unterbunden werden. Dafür sind klare gesetzliche Vorgaben in Landesgesetzen notwendig, um beim Versammlungsrecht die Pflicht zum Schutz der Presse festzuschreiben, so wie es bereits in Berlin der Fall ist.