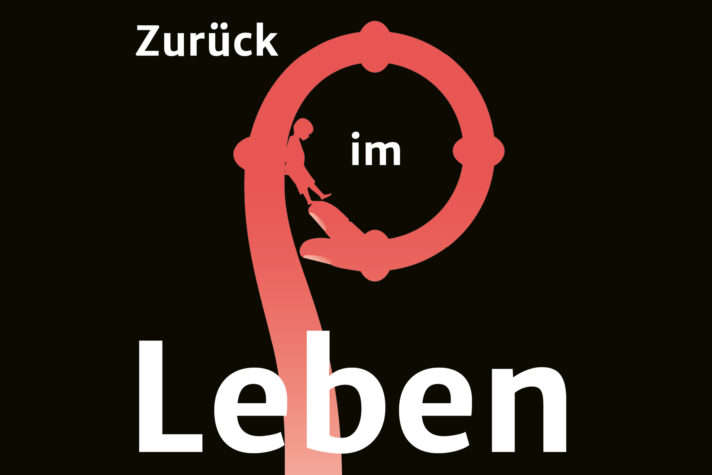Wenn er aus seinem Wohnzimmer schaut, den Kopf nach rechts neigt, den Blick schweifen lässt über die Schieferdächer und den kleinen Fluss, dann sieht er da auf der anderen Seite des Hangs seine eigene Vergangenheit stehen. In dem alten Rathaus, das dort steht, ein Gründerzeitbau, hat Andreas Hollstein das Städtchen Altena seit 1999 als Bürgermeister regiert. Er war der erste Bürger einer schrumpfenden Stadt. Das gibt den Ton vor, denn in einer wachsenden Gemeinde regiert es sich vermutlich anders als in einer, in der Niedergang die Rahmenbedingungen setzt.
Die Drahtproduktion hatte Altena einst groß werden lassen, Wohlstand und Arbeitsplätze in diesen Ort am nördlichen Rand des Sauerlands gebracht. Als die Drahtproduktion der Welt umzog, da nahm sie viele Arbeitsplätze mit. Mit ihnen gingen viele Perspektiven und das Geld und in der Folge Menschen. In Blütezeiten wohnten in Altena rund 30.000 Menschen, heute sind es noch gut 17.000. Im Jahr 1999, als Hollstein seine erste Wahl gewann und das bis dahin rote Städtchen schwarz wurde, lebten noch 22.000 Menschen in der Stadt.
In Altena steht eine hübsche Burg auf dem Klusenberg, sie ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Region. Von der rund 900 Jahre alten Burg führt ein Aufzug durch das Gestein des Berges zum Ufer des Flusses in die Innenstadt, was praktisch ist für die, die den steilen Weg zur Burg hinauf nicht zu Fuß gehen möchten. Auf halbem Weg zur Burg wohnt Hollstein in einem historischen Haus, verwinkelt, selber ein bisschen eine Burg. Weiter unten in der Stadt wurde er niedergestochen, damals, als er noch Bürgermeister war. Das war 2017. Die Messerattacke war der Gipfel einer Entwicklung von Hass und Hetze, die Hollstein über Jahre gespürt hatte. Dass sie ihn in so einer Konsequenz treffen würde, hätte er sich dennoch nicht vorstellen können. Heute, im Rückblick, sieht Hollstein drei verschiedene Phasen dieser Entwicklung.
Phase 1: 1999 – 2005
Wer sich umhört in Altena, wie Hollstein 1999 loslegt als Bürgermeister, der bekommt das Bild eines Mannes vermittelt, der Unangenehmes ausspricht, bevor er gewählt wird. Und der das dann umsetzt, auch im eigenen Beritt: Die Verwaltung wird verkleinert, von 180 auf 120 Vollzeitstellen. Hollstein schafft den Dienst-Mercedes samt Chauffeur ab und fährt fortan im Dienst-Polo selbst durch die Kleinstadt. Was viel über den politischen Instinkt von Hollstein verrät. Das, was man sagt, auch selber vorzuleben, erhöht die Akzeptanz. Gelingen garantiert es nicht und Schwimmbad-, Schul- und Kindergartenschließungen bleiben kein Spaß, sondern hochemotionale Angelegenheiten.
Aber was soll man machen, wenn man Konkursverwalter einer klammen Gemeinde ist, die zum Beispiel zwei Schwimmbäder unterhält? Man kann sie beide verrotten lassen, was am Anfang ein bisschen Ruhe bringt, aber in der Konsequenz zu gar keinem Schwimmbad mehr führt. Oder man schließt ein Schwimmbad und saniert das andere. Hollstein sagt, man habe sich damals für Variante zwei entschieden.

Hollsteins Kinder werden beschimpft
Es werden 3.000 Unterschriften gegen die Schließung gesammelt, es wird ein Bürgerbegehren eingeleitet, ein Rechtsstreit folgt und letztlich wird ein Bad geschlossen. Die Kinder von Hollstein werden daraufhin in der Grundschule beschimpft: „Dein Vater zerstört unsere Stadt, dein Vater lässt uns nicht mehr schwimmen, dein Vater ist ein Unmensch.“ Nicht so schön sei das gewesen, sagt Hollstein rückblickend, und dass es eine Menge solcher Entscheidungen und entsprechender Folgen gegeben habe. Vielleicht hat es so etwas bei unbeliebten Entscheidungen aber schon immer gegeben.
„Dein Vater zerstört unsere Stadt, dein Vater lässt uns nicht mehr schwimmen, dein Vater ist ein Unmensch.“
– So wurden Hollsteins Kinder in der Schule beschimpft
Wer den Menschen etwas zumutet, muss mit der Konsequenz leben, dass er eventuell respektiert, aber nicht zwingend geliebt wird. Für Hollstein zeigt sich das – wir sind hier im Sauerland – zunächst ganz vereinzelt bei den Schützenfesten: Alkohol, Menschen, die sich und vor allen Dingen anderen etwas beweisen wollen, gelöste Zungen, Konsequenzen für den Moment egal – in der Summe führt das gelegentlich zu Pöbeleien. Wenn es einmal im Jahr vorkam, sei das schon viel gewesen. Nichts, worüber man lange nachdenken muss. Das hat es wohl immer schon gegeben. Hat es?
Stutzen lässt Hollstein dagegen ein Brief, den er recht bald nach seiner Amtsübernahme bekommt. In dem Schreiben geht es um eine Seitenstraße mit vielleicht 150 Anwohnern, unter ihnen 20, 25 Kinder. Die Straße hat mindestens seit Ende des Zweiten Weltkriegs keinen befestigten Gehweg, auf ihr wird schnell gefahren, alles in allem ein Problem. Dazu Post samt Unterschriftenliste zu bekommen, ist kein ungewöhnlicher Vorgang. Ungewöhnlich kommt dem Juristen Hollstein der Ton des Anschreibens vor. Darin steht nichts von einer Bitte um Überprüfung der Verkehrssituation, stattdessen wird dem Bürgermeister eine Ansage gemacht: Wenn einem unserer Kinder etwas passiert, steht da geschrieben, dann machen wir Sie persönlich dafür haftbar. Der Ton ist neu, vielleicht auch befremdlich, die Sache geht dann ihren verwaltungstechnischen Gang und wird überprüft.
Gute zwei Jahre später soll die Straße dann saniert werden – mit Eigenmitteln der Anlieger. Es wird eine Einwohnerversammlung einberufen. „Und da schlug mir zum allerersten Mal Hass entgegen“, sagt Hollstein heute im Rückblick. Die Stimmung sei massiv hochgekocht: „Du kannst hier doch nicht plötzlich eine Straße bauen, wir brauchen die doch gar nicht“, habe man ihm entgegengebrüllt. Er habe dann das Schreiben gezeigt, das er bekommen habe. So habe man das doch gar nicht gemeint, sei ihm entgegnet worden.
Rechte vor Pflichten
Hollstein lernt in diesem Moment etwas, was ihm noch häufiger begegnen sollte: „Straßenausbau ist, das können Kollegen bestätigen, ein riesiger Aufreger.“ Er nennt das heute einen „kriegsauslösenden Zustand“, in dem die Fronten sehr schnell verhärten und nicht mehr miteinander gesprochen wird. Andere „kriegsauslösende Zustände“ sind Natur und Ökonomie, Migration und grundsätzlich neue Investitionen.
Die Straße ist inzwischen ausgebaut, der Zorn verraucht, die Straße ist eine Straße mit Bürgersteig. Man kann in ihr, wenn man ihre Geschichte im Kopf hat, aber auch mehr sehen: Die Bundesrepublik Deutschland hat nach dem Aufbau in den Wirtschaftswunderjahren angefangen, in einer Wohlstands-blase zu leben. Alle wesentlichen Kennziffern zeigten immer nur nach oben, die Blase „haben wir immer weiter aufgepumpt“, sagt Hollstein. Jeder Mensch hat seine Nische gefunden, sich darin eingerichtet und die Eigeninteressen zum Daseinszweck erhoben. Das Wissen von Rechten und Pflichten wird vorrangig zum Wissen um die eigenen Rechte. Die Anerkennung der Pflichten rückt in den Hintergrund. Oder, anders formuliert: Wir machen Dich verantwortlich, wenn einem unserer Kinder etwas passiert. Aber lass bloß die Finger von unserem Geld.
Phase 2: 2005 – 2012
Das sogenannte Abstandsgebot besagt, dass Arbeit stets mehr einbringen muss als Nichtarbeit. Dieses Abstandsgebot ist Anfang der Nullerjahre verletzt, nachdem die Bundesrepublik ihre Arbeitslosen mit Unterstützungszahlungen und Lohnersatzleistungen viele Jahre weit über dem europäischen Durchschnitt versorgt hat. Als Konsequenz daraus verabschieden Bundesrat und Bundestag 2005 die sogenannten Hartz-IV-Reformen, was zu schmerzhaften Einschnitten in der Arbeitslosenhilfe führt.
Dagegensein wird zum Prinzip
Die Hartz-Gesetzgebung wird heute noch harsch kritisiert, der Umgang mit finanzschwachen Menschen ist in Deutschland kein Ruhmesblatt. Aber auch wenn Bundesrat und Bundestag und vor allen Dingen der damalige Kanzler Gerhard Schröder für die Hartz-Gesetze verantwortlich zeichnen, haben in dieser Zeit die Rathäuser vor Ort, die Sachbearbeiter mit dem Zorn darüber zu leben. Beleidigungen im Sozialamt zum Beispiel nehmen damals, so sieht es Hollstein heute, deutlich zu. „Ab 2005 veränderte sich das Klima weiter, es wurde heftiger.“

Erstmals geht es nicht permanent weiter aufwärts, es hakt deutlich. Und jeder, dem etwas weggenommen wird, wehrt sich dagegen. Man habe manchmal den Eindruck gehabt, sagt Hollstein, dass damals in Folge der Hartz-Reformen alles, was von „oben“ kommt, in Zweifel gezogen und für falsch gehalten wird. „Dagegensein“ wird zum Prinzip und Kommunen sind die, die für den Bürger erreichbar sind. Angst ist eine starke Triebfeder, das gilt auch für die Angst vor dem finanziellen Abstieg.
Verbale Drohungen nehmen damals zu, ab und an seien Stühle im Rathaus geflogen. Wobei nicht nur, aber eben auch die Rathäuser ihren Teil zur allgemeinen Stimmung beitragen. Häufig sei der Fehler gemacht worden, in die Abteilungen mit den meisten Bürgerkontakten nicht die kommunikativ stärksten Mitarbeiter zu setzen. Die braucht man in anderen Abteilungen, dort, wo ein Rathaus glänzen kann oder will, in der Außendarstellung etwa. Und so sehen sich also diejenigen mit den meisten Bürgerkontakten einer veränderten Erwartungshaltung gegenüber, mit der sie nur schwer umgehen können.
Attacken gegen Politiker nehmen zu
Im Jahr 1970 zum Beispiel hätte ein Bürger beim Sozialamt vermutlich gesagt: „Ich brauche, ich möchte, prüfen Sie bitte.“ Heute ist der Ton laut Hollstein ein anderer: „Ich brauche jetzt, warum prüfen Sie eigentlich noch, her damit.“ Seit den 1970er-Jahren hat die Bevölkerung sich emanzipiert, die Menschen werden zu mündigen Bürgern, Dialogprozesse kommen in Gang, Mitwirkungen, Beteiligungsverfahren. Dinge, die in einer sich verändernden Demokratie alle auch ihre Berechtigung haben. Hollstein findet aber, dass sich die Situation aus Perspektive der Rathäuser so darstelle, dass die Bürger oder zumindest ein nicht unerheblicher Teil von ihnen davon ausgeht, bestimmen zu können, was ist – und die da in ihren Räten und Amtsstuben machen können, was sie wollen.
Kollegen schildern ihm damals ähnliche Erfahrungen. Wie sie in Einwohnerversammlungen gar nicht mehr zu Wort kommen. Attacken gegen Mandatsträger etwa hatte es schon vorher gegeben. Aber so ab 2005 habe das dann langsam, aber kontinuierlich zugenommen, auch wenn nicht alle offen darüber gesprochen hätten. Vielschichtiger, massiver, sei das zunehmend geworden, bis dann 2012 die ersten Drohmails bei Hollstein ankommen. Hier beginnt für ihn die dritte Phase, die heute noch anhält und mit der wir in der Gegenwart angekommen sind.

Phase 3: 2012 – heute
Die erste Drohmail, die an ihn gerichtet ist, schmeißt Hollstein weg, die zweite auch, dann die dritte und so weiter. Er ist damals ein nach wie vor anerkannter Bürgermeister – bürgernah. Einer, der gut mit den Menschen kann, der sich regelmäßig mit einem Tisch auf den Marktplatz stellt, um ins Gespräch zu kommen. Hören, wo der Schuh drückt. Das ist die eine Seite – die öffentliche.
Die digitale Seite aber verändert sich: Während er in den ersten Mails angegangen oder beschimpft wurde, wird der Charakter der Mails langsam ein anderer, ein orchestrierter. Menschen beginnen, sich digital zusammenzuschließen. Plötzlich bekommt er nicht mehr nur unangenehme Mails, die sich auf singuläre Ereignisse vor Ort beziehen. 2014 beginnt Hollstein öffentlich darauf hinzuweisen, dass Angriffe auf Mandatsträger zunehmen, und nicht nur auf sie. Ein Ordnungsamtsmitarbeiter soll eine Straßensperrung anlässlich eines Mittelalterfestes kontrollieren. Ein Autofahrer hält mit seinem Wagen auf den Mitarbeiter zu und fährt ihm letztlich über den Fuß. Das endete dann in einem Gerichtsverfahren samt Verurteilung.
In der „Brennglasphase“
Hollstein nennt diese dritte Phase eine „Brennglasphase“, die sich 2015 im Zuge der Migration noch einmal hoch emotionalisiert. Menschen auf der Flucht, die zu Hunderttausenden nach Deutschland kommen. Die erst aufgenommen werden von einem Land, das sich selbst und andere überrascht mit seiner Menschlichkeit und das dann erlebt, wie die AfD erstarkt, wie die Grenzen des Sagbaren zunehmend verschoben werden.
Am 3. Oktober 2015 kommt es in Altena zu einem Brandanschlag auf ein Mehrfamilienhaus, in dem mehrere Migrantenfamilien leben. Wenige Tage vor der Tat hatte Altena öffentlich gemacht, dass es mehr Flüchtlinge aufnehmen werde als die 100, die der Stadt zugewiesen waren. 100 weitere wolle man aufnehmen, wenn es sich einerseits um Bürgerkriegsflüchtlinge und andererseits größtenteils um Familien handle. Brandstifter sind ein Feuerwehrmann und sein Komplize, als Motiv gibt einer der Täter später an, er habe Angst vor „Einbrüchen, Diebstählen, Gewalttaten und auch vor sexuellen Übergriffen“ der Flüchtlinge gehabt.
Hollstein kennt die Familie des Täters sowie den Täter selbst. Was sich während des Gerichtsverfahrens in den Handyauswertungen zeigt, hätte er nicht für möglich gehalten: Holocaust-Leugnung, SS-Verherrlichung, das ganze Programm. Die Täter waren vernetzt, hier waren Menschen nicht einzeln aktiv. Hier waren Menschen zu Tätern geworden, die sich gegenseitig in ihren Meinungen bestärkten, die davon ausgingen, dass ihre Wahrheit und Weltsicht die einzig richtigen seien.

Messerattacke auf Henriette Reker
Zwei Wochen nach dem Brandanschlag in Altena, am Oktober 2015, wird im Kölner Stadtteil Braunsfeld die damalige Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Reker mit einem Messer attackiert und schwerst verletzt, sie wird ins künstliche Koma versetzt. Später sollte der Täter, ein Mann mit Kontakten ins neonazistische Milieu, angeben, der Grund für seine Tat sei Rekers Flüchtlingspolitik gewesen. Reker war damals noch Kölner Sozialdezernentin und als solche für die Unterbringung von geflüchteten Menschen zuständig. Der damals 44-jährige Täter soll dem „Spiegel“ zufolge laut Augenzeugenberichten bei der Attacke gerufen haben: „Ich tue es für eure Kinder.“
Hollstein spricht 2016 bei einer Tagung mit Kollegen über die zunehmenden Attacken per Mail und es wird klar, dass nicht nur er angegangen wird. Er ist kein Einzelfall, viele können etwas erzählen: von Beleidigungen, vom Angehen der eigenen Kinder, von abgeschnittenen Weinreben oder gelösten Radmuttern. Und die Situation beruhigt sich nicht. Im Sommer 2017 ist Hollstein bei der Polittalk-Sendung Maybrit Illner zu Gast, im Anschluss explodiert förmlich sein Maileingang. Ein paar wenige positive Mails sind darunter, der Großteil jedoch Attacken, Hass und Hetze. Hollstein beginnt, konsequent anzuzeigen.
„Wir gegen die“ ist immer die Grundlage von Hass und Hetze. „Da ist jemand, der möchte mir etwas wegnehmen, der will etwas verändern, dagegen muss ich mich wehren, mein Verhalten ist Notwehr, ich bin doch hier in der Opferrolle, also muss ich handeln.“ Jede Tat erscheint dem Täter legitimiert, weil er sich selbst für das eigentliche Opfer hält. In seiner Weltsicht muss er die Tat begehen, für sich, sein Volk oder dessen Kinder. Aber wenn alle nur noch Opfer sind, dann ist niemand mehr schuldig, dann wird alles egal.

Diese Phase, in der sich unsere Gesellschaft gerade befindet, nennt Hollstein die „Brennglasphase“. Es wird immer hitziger. Jeder, der als Kind in einem heißen Sommer mit einem Brennglas und trockenem Gras hantiert hat, weiß, was dann passiert. „Brennt uns gleich die Hütte ab, weil das Gras davor schon in Flammen steht, Herr Hollstein?“
„Als positiv denkender Mensch, der politisch tätig ist, würde ich sagen, da sind wir noch lange nicht. Man kann Prozesse ja auch verändern und Menschen überzeugen. Aber es wird nicht leichter, wenn man nicht genau genug hinsieht.“ Das sei, sagt er, ähnlich wie ein Krankheitsverlauf: Am Anfang einer Erkrankung kann man in der Regel am einfachsten heilen. Wenn Symptome ignoriert werden, hat man schnell ein Problem. Dann ist man irgendwann tot. Interessant, dass er den Tod erwähnt, denn der Krankheitsverlauf der Diagnose Hass und Hetze trifft ihn selbst massiv, damals, am 27. November 2017 in einem Döner-Imbiss, als auch er mit einem Messer attackiert wird.
Angriff im Dönerladen
An dem Abend kommt Hollstein aus dem Rathaus. Er fährt mit dem Wagen nach Hause, seine Ehefrau ist krank. Dann geht er noch einmal kurz bei einem Dönerladen vorbei, um ein gemeinsames Abendessen zu holen. Es ist ungefähr 20 Uhr, kurz nach ihm betritt ein weiterer Mann den Laden. Er hat einen Jutebeutel dabei und fragt Hollstein: „Sind Sie der Bürgermeister?“ „Ich kenne die Frage, sie ist oft eine Brücke“, sagt Hollstein, „und habe geantwortet: ‚Ja, warum?‘, um zu signalisieren: Haben Sie etwas für mich, kann ich etwas für Sie tun?“
Statt zu antworten, zieht der Mann ein Messer. Dann schreit er: „Du lässt mich verdursten und holst 200 Ausländer rein.“ Das Messer am Hals Hollsteins, Handgemenge, der Dönerladenbetreiber und sein Sohn eilen zu Hilfe. Ein vierminütiger Kampf, Geschrei, es fließt Blut, das von Hollstein. Aus einer Wunde am Hals. Letztlich ist der Täter fixiert, die Polizei wird gerufen. Als eine junge Polizistin – die Polizeiwache ist um die Ecke – in den Laden stürmt, eine gezogene Waffe in der Hand, schreit der Täter sie an: „Erschieß mich!“

Täter erhält Bewährungsstrafe
Im Juni 2018 wird der 56-jährige Täter wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung zu einer zweijährigen Haftstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Der Mann, so sah es das Gericht, war psychisch labil und zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Er hatte, so das Gericht, das Messer zur Selbstverteidigung dabei. Auch einen Glasschneider hatte er dabei, was aber bei der Urteilsfindung keine Rolle spielte. Dieser Glasschneider lässt für Andreas Hollstein noch eine andere Interpretation zu: Was, wenn der Mann gar nicht in den Dönerladen wollte? Was, wenn er den Glasschneider dabeihatte, um in Hollsteins Wohnhaus einzudringen?
Das hätte auch ganz anders ausgehen können, meint Hollstein heute. Er ist davon überzeugt, dass er, hätten Vater und Sohn in dem Imbissladen nicht eingegriffen, heute nicht mehr leben würde. Seine Kraft habe nicht ausgereicht, sich zu wehren. Ein Bürgermeister wäre heute tot – als letzte Konsequenz von Hass und Hetze. Das Gericht war anderer Ansicht, der Angreifer habe den Bürgermeister erschrecken wollen. Aber ruft einer, der nur erschrecken will, den zum Tatort kommenden Polizisten dann „Erschieß mich!“ zu? Hollstein findet das alles unlogisch. „Aber das ist gelaufen“, sagt er nach einer längeren Pause. „Man muss das irgendwann abhaken.“

Für Hollstein ist der Mann der Täter, aber eben auch ein Werkzeug der, so nennt er es, „digitalen Brunnenvergifter“. Denen, die die Echokammern des Internets füllen, die rechte Parolen endlos wiederholen, die den Verwirrten und Verirrten das Gefühl geben, nicht alleine zu sein, sondern zu einer schweigenden Mehrheit zu gehören. Und praktischerweise kommt das ja alles auf den eigenen Bildschirm, in die eigenen vier Wände. Keiner muss mehr aktiv werden, alles kommt von ganz allein und wird immer mehr, wenn man einmal damit begonnen hat. Wenig Freunde habe der Mann gehabt, aber im Netz sei er aktiv gewesen. In sozialen Netzwerken, auch den einschlägigen, war er viel unterwegs – und in einer entsprechenden Kneipe.
Entscheidend sei dann gewesen, dass der Mann persönliche Probleme gehabt habe. Darin sieht Hollstein den „Auslöser von Gedankengängen in die Tat“: Frau weg, von der Welt verraten gefühlt, Jobverlust, Alkohol, Verwahrlosung, am Ende eine Kurzschlussreaktion. Auch hier wieder die Opferrolle, andere sind schuld für eigenes Versagen, man muss sich wehren. „Mir geht es scheiße und du bist schuld“ quasi als Lebensentwurf. Wobei schuldig hier vermutlich der ist, den man erwischen kann.
Hollstein, Reker – Einzelfälle?
Hollstein, Reker, in der Dimension sind die beiden Fälle singulär. Aber Einzelfälle? „Kommunal“ ist eine monatlich erscheinende Zeitschrift für Bürgermeister und Kommunalpolitiker. Auf der dazugehörigen Online-Plattform www.kommunal.de wird im März 2020 eine Umfrage veröffentlicht, an der 2.494 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister teilgenommen haben. 64 Prozent geben an, im Rahmen ihrer Tätigkeit „beleidigt, beschimpft, bedroht oder tätlich angegriffen“ worden zu sein. Das sei, so die Publikation, schon lange kein Großstadtphänomen mehr.
Und diese Umfrage war ausgearbeitet worden, bevor Corona ins Spiel kam. Ende Januar 2021 berichtet „kommunal“, dass nun 27 Prozent der Stadtoberhäupter angäben, wegen der Corona-Krise habe die Zahl der Anfeindungen und Beleidigungen noch einmal weiter zugenommen.
Demokratie lebt von der Beteiligung. Aber was passiert, wenn sich immer mehr Menschen nicht beteiligen wollen, weil sie lieber ihre Ruhe haben und nicht angegangen werden wollen? Laut „kommunal“ waren sich bereits im März 2020 29 Prozent der befragten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sicher, nicht für eine weitere Amtszeit antreten zu wollen. Besonders hoch sei dieser Wert bei den meist ehrenamtlichen Bürgermeistern in kleinen Gemeinden. An dieser Stelle zeigen Hass und Hetze sich als das, was sie sind: demokratiegefährdend.

Es scheint nicht wahrscheinlich, dass die erschreckenden Prozentzahlen aus der Umfrage in der näheren Zukunft sinken werden. Kinderbetreuung in Corona-Zeiten, Impstoffvergabe-Ärger, die wirtschaftlichen Existenzängste von Einzelhändlern, all das steigert den Druck auf die Kommunalpolitik. Und das ist nicht alles: Mit den prognostiziert einbrechenden Steuereinnahmen der Kommunen sinkt auch deren Handlungsspielraum. Im Moment etwa sind Schwimmbäder coronabedingt geschlossen. Aber werden sie auch wieder öffnen?
Andreas Hollstein, 57 Jahre alt, ist momentan Privatier. Er war im Sommer 2020 als CDU-Oberbürgermeisterkandidat für die benachbarte Großstadt Dortmund ins Rennen gegangen und hatte dort im Herbst die Stichwahl gegen den SPD-Kandidaten knapp verloren. Ende Oktober 2020 endete seine Zeit als Bürgermeister in Altena. Was die Zukunft für ihn bringen wird, weiß er noch nicht genau, es gibt verschiedene Gedanken, aber noch nichts Spruchreifes. Er ist jetzt ein Veteran der Lokalpolitik, übergriffige Mails hat er länger nicht mehr bekommen.
Was rät er Menschen, die sich politisch engagieren wollen aus seiner Perspektive?
Sich zurückzuziehen sei keine Option, sagt er. Ansprechen müsse man Hass und Hetze immer wieder, dadurch Standfestigkeit zeigen, sich gesellschaftlich engagieren. Wenn alle, die es könnten, den Mund nicht aufmachen, werde der Effekt immer stärker und an Dynamik gewinnen. Gegenhalten, ja schon, aber auch einfach wieder diskutieren, sich über politische Lager hinweg austauschen. Heute werde ja über Politik kaum noch gesprochen, um keinen Streit zu bekommen. Oder man sei sich ohnehin einig, weil man sich nur noch mit Menschen austauscht, die die eigene Meinung teilen.
Austausch, Diskussion, ringen mit Worten, all das klingt richtig und gut. Und ist in Corona-Zeiten natürlich hochproblematisch, weil ein normaler Austausch im Privatleben gar nicht möglich ist. Geht ja alles nur noch im Netz. Und da sind die Algorithmen vor. Die, die Emotionen belohnen und jeden immer tiefer in das bringen, was man selber für richtig hält.
Alles nur noch schwarz und weiß.
Tobias Großekemper
Andreas Hollstein wurde 1963 in Altena geboren und war zwischen 1999 und 2020 Bürgermeister der Kleinstadt in Westfalen.