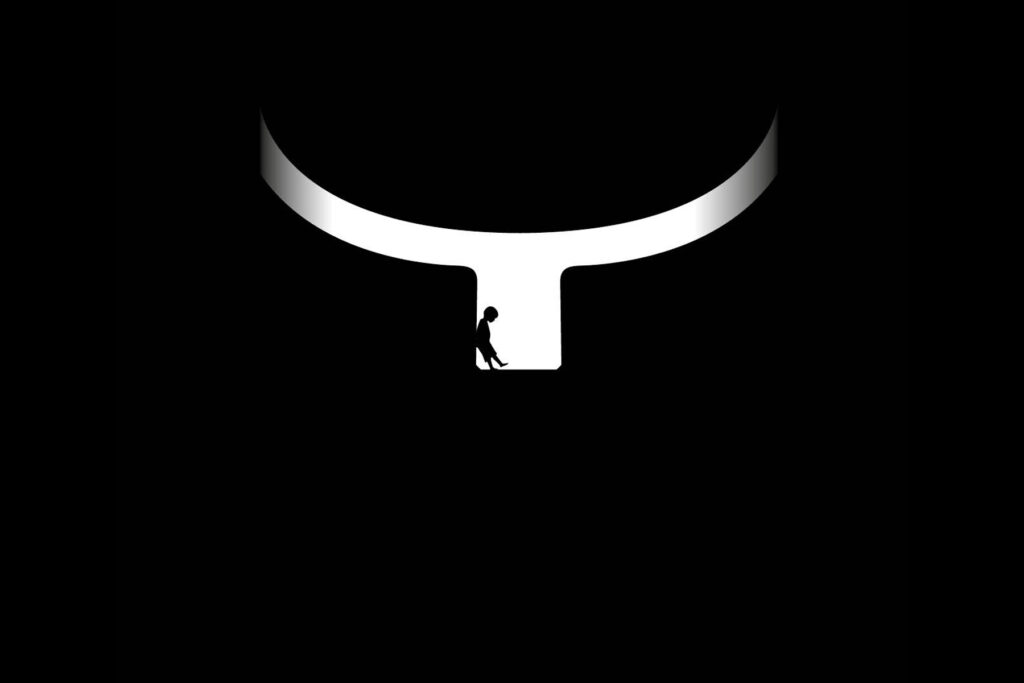Eine Frau sagt, ein Pfarrer habe sie in ihrer Kindheit sexuell missbraucht. Der Pfarrer streitet alles ab. Juristisch ist die Tat verjährt, der Staat ermittelt nicht. Aber die Frau und der Vorwurf sind trotzdem da. Wer geht der Sache jetzt nach? Wer sorgt für Aufklärung? Wer prüft, ob es vielleicht andere Betroffene gibt?
Ein Text über eine monatelange Suche nach Antworten, über hilflose Institutionen und über eine Frau, die hilfelos bleibt.
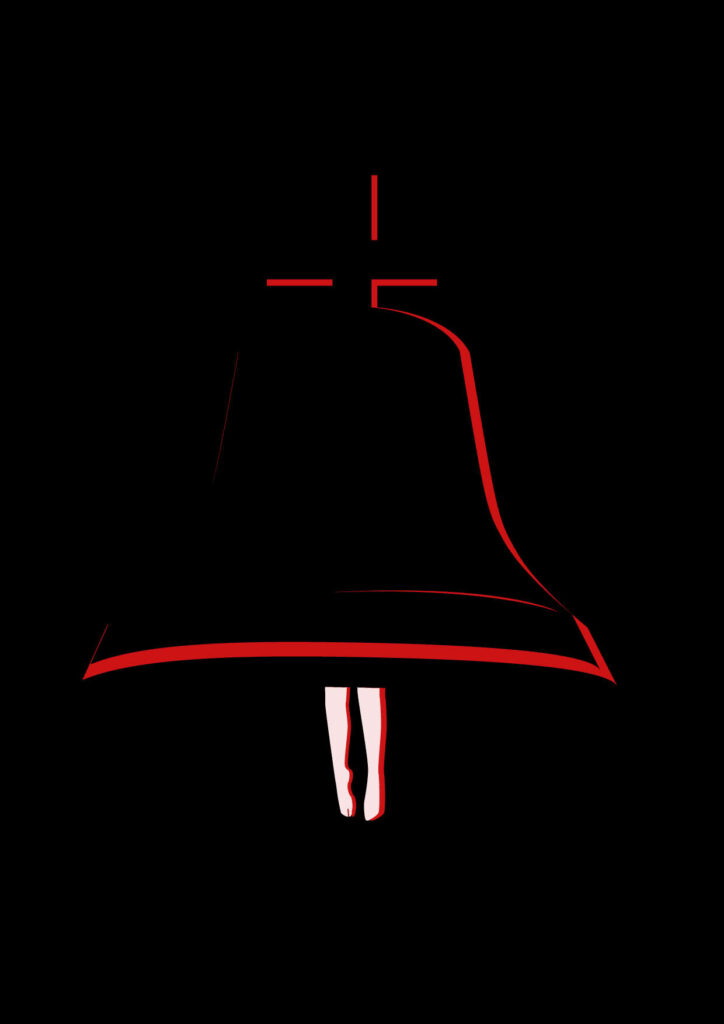
Sie sieht noch alles vor sich: den Kindergarten, den Raum mit Tisch und Stuhl, die brennende Kerze auf dem Tisch. Den Pfarrer in seinem schwarzen Anzug. Die Mutter, die sie allein zum Pfarrer hineinschickt. Sie sieht sich selbst, sieben Jahre alt: ein kleines Mädchen voller Angst, das seine erste Beichte vor der Erstkommunion ablegen soll.
Was in dem Raum passiert, sieht sie nicht.
Ihre Erinnerung setzt erst am Abend wieder ein. Sie liegt im Bett mit ihrer kleinen Schwester und zeigt ihr die Verletzungen, diese großen roten Flecken. Sie erzählt ihr von den Schmerzen und vom Brennen im Intimbereich. Die Schwester sagt, das musst du der Mutter sagen! Als die Mutter zum Abendgebet zu ihr ans Bett kommt, fasst sie sich ein Herz. Sie bittet die Mutter: „Der Papa muss dem Pfarrer sagen, dass er so etwas nie wieder machen darf!“
Sie hört noch die Antwort der Mutter: „Über so etwas darfst du mit niemandem reden! Über so etwas musst du für immer schweigen!“
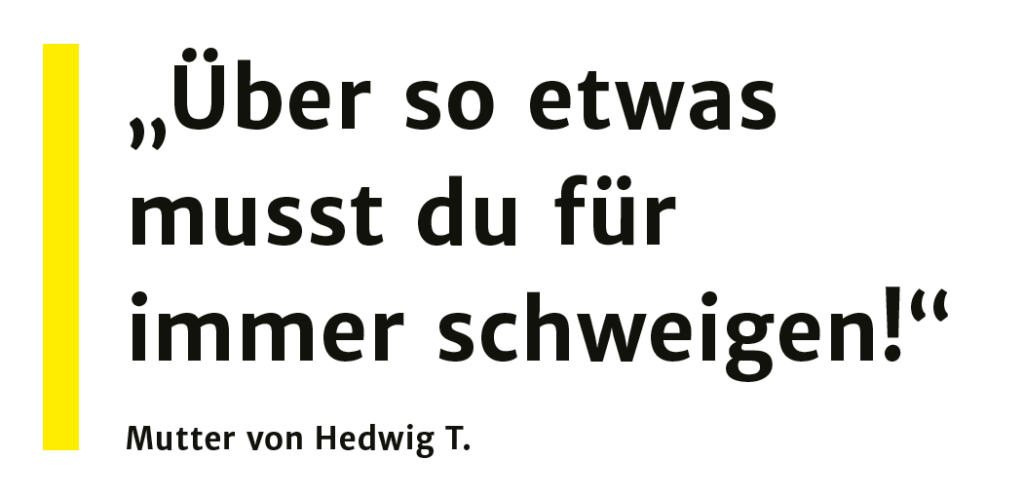
45 Jahre später sitzt das kleine Mädchen von damals vor einem Nürnberger Altstadtcafé in der Sonne und spricht. Hedwig T. ist 53 Jahre alt, sie hat alle Verbindungen abgebrochen zu dem kleinen Dorf im Norden des Bistums Münster, wo sie damals auf den Pfarrer traf. „Ausgelöscht“ hätten sie die Sätze ihrer Mutter. „Mein bisheriges Leben war von nun an vorbei. Es fühlte sich an, als hätte ich ein schlimmes Verbrechen begangen.“ Sie zog sich zurück. Die anderen Kinder im Dorf sagten über sie: Mit der kannst du nichts anfangen, die guckt nur aus dem Fenster, die ist so still.
Sie war still. Bis zu dem Tag, als sie nach 44 Jahren zufällig den Namen des Pfarrers in einem Zeitungsartikel las und Wut in ihr aufstieg.
Das Bistum
Als Frau T. nicht länger schweigen will, geht sie zu einer Rechtsanwältin. Die Anwältin setzt am 23. Februar 2021 ein Schreiben ans Bistum Münster auf, in dem sie die Erinnerungen von Frau T. schildert. Sie erklärt, dass Frau T. ihr jahrzehntelanges Schweigen nun brechen und den Missbrauch öffentlich machen wolle.
Der Interventionsbeauftragte des Bistums, Peter Frings, reagiert postwendend. Er hat vor allem Fragen: Wird Frau T. die Staatsanwaltschaft einschalten? Gibt es Zeugen der Tat? Was ist mit Mutter und Schwester, könnten sie Auskunft geben?
Die Interventionsstelle hat in den vergangenen drei Jahren Hunderte von Missbrauchsvorwürfen bearbeitet. Fast schon routiniert befolgen die Mitarbeiter die „Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger“, eine Arbeitsanweisung, die der Bischof 2019 für derartige Fälle erlassen hat. Sie befolgen Ziffer 33 der „Ordnung“: Am 18. März leitet das Bistum die Anzeige von Frau T. an die Staatsanwaltschaft Münster weiter. Die Staatsanwaltschaft Münster leitet die Anzeige am 13. April wiederum weiter an die Staatsanwaltschaft Oldenburg, in deren Zuständigkeitsbereich das kleine Dorf im Norden des Bistums fällt.
Das Bistum befolgt Ziffer 36: Ebenfalls am 13. April setzt der Bischof von Münster per Dekret Herrn B., einen pensionierten Kriminalhauptkommissar, als Voruntersuchungsführer ein. B. soll prüfen, ob der Pfarrer im Fall T. möglicherweise gegen das Kirchenrecht verstoßen hat, indem er „mit Gewalt oder durch Drohungen oder Missbrauch seiner Autorität (…) jemand gezwungen hat, sexuelle Handlungen vorzunehmen oder zu ertragen“.
Aber vorerst gibt es die Voruntersuchung nur auf dem Papier: „Während staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen hält sich ein Voruntersuchungsführer stets zurück“, teilt der Interventionsbeauftragte Frau T. mit.
Die Staatsanwaltschaft
Für die Aufklärung und Verfolgung von Straftaten ist in Deutschland die Staatsanwaltschaft zuständig, so sieht es nicht nur das Bistum, so regelt es die Strafprozessordnung. Allerdings sind der Staatsanwaltschaft enge Grenzen gesetzt: Sie darf nur dann aufklären und verfolgen, wenn ein sogenannter Anfangsverdacht vorliegt. Ohne diesen Anfangsverdacht darf sie keine Zeugen hören, keine Beschuldigten vernehmen, keine Durchsuchungen anordnen.
Wörtlich heißt es in der Strafprozessordnung: Die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, bei „verfolgbaren Straftaten“ einzuschreiten, „sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen“.
Nicht „verfolgbar“ ist eine Straftat zum Beispiel, wenn sie verjährt ist. Juristen sprechen in solch einem Fall von einem „Strafverfolgungshindernis“. Wenn bei der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige wie die von Frau T. eingeht, prüft sie deshalb zunächst, ob eine Verjährungsfrist für die angezeigte Tat gilt.
Im Fall von Frau T. ist das nicht so einfach. Weil Frau T. sich nicht erinnert, was genau 1977 in dem Kindergarten geschah, kann die Staatsanwaltschaft keinen konkreten Tatvorwurf benennen, den sie verfolgen könnte. Für die Berechnung einer möglichen Verjährung nimmt der zuständige Staatsanwalt deshalb „die schwerste denkbare Sexualstraftat nach damaligem Recht“ zum Maßstab, wie er der Anwältin von Frau T. später mitteilt: Vergewaltigung. Seine Berechnung ergibt, dass diese Tat im Jahr 2007 verjährt gewesen wäre.
Am 10. Mai 2021, zweieinhalb Monate nach der Anzeige von Frau T., verschickt der Staatsanwalt einen Einstellungsbescheid. „Von der Aufnahme von Ermittlungen habe ich abgesehen, da Verjährung eingetreten ist“, schreibt er.
Weil die Staatsanwaltschaft nicht ermitteln darf, spricht sie nicht mit dem Beschuldigten und nicht mit Frau T., sie hört keine Zeugen und sichtet keine Akten. Sie prüft nicht, ob der Vorwurf von Frau T. zutrifft oder nicht.
Die Staatsanwaltschaft kann Frau T. keine Aufklärung geben. Aber sie gibt ihr etwas, das viele Missbrauchsopfer kennen: das Gefühl, dass man ihr nicht glaubt. Im Einstellungsbescheid spricht der Staatsanwalt nicht von einer Tat, sondern von einem „vermuteten Vorfall“.
Das Bistum, noch einmal
Wenn die Staatsanwaltschaft nicht ermittelt, muss sich der Voruntersuchungsführer des Bistums nicht länger zurückhalten.
Wie ein Voruntersuchungsführer ermittelt, das bestimmt er selbst. Der Interventionsbeauftragte des Bistums sagt: „Wir lassen diese Voruntersuchungsführer laufen.“
Im Fall T. läuft der Voruntersuchungsführer so: Er spricht nicht mit Frau T., die den Missbrauchsvorwurf erhoben hat. Er spricht nicht mit dem Pfarrer, gegen den sich der Missbrauchsvorwurf richtet. Er ermittelt nicht in dem kleinen Dorf, wo sich der Missbrauch zugetragen haben soll. Der Voruntersuchungsführer sichtet die Schriftwechsel mit den Ausführungen von Frau T. und Dokumente wie die Personalakte des beschuldigten Pfarrers. In einem Aktenvermerk hält B. fest: „Hinweise auf Beschwerden oder den Verdacht übergriffigen Verhaltens oder gar sexuellen Missbrauchs sind der Personalakte nicht zu entnehmen.“
Am 18. Juni 2021 liefert der Voruntersuchungsführer seinen dreieinhalbseitigen Schlussbericht ab, so wie es Ziffer 37 der „Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch“ vorschreibt. „Die Äußerungen von Frau T. deuten stark auf eine Fiktion hin“, berichtet er. Er schreibt von „bloßen Vermutungen“ und „fiktive(n) Vorstellungen, die sie für Erinnerung hält“, er nennt die Schilderung von Frau T. „nicht glaubwürdig“.
Auf der Internetseite des Bistums zum Thema sexueller Missbrauch steht: „Für das Bistum Münster gilt, dass es den Betroffenen grundsätzlich glaubt!“ Doch so einfach ist das mit dem Glauben in der Kirche nicht. Als Frau T. den Schlussbericht liest, hat sie nicht mehr nur das Gefühl, dass man ihr nicht glaubt. Sie weiß es jetzt.
Die Opferanwältin
Antje Steiner, Rechtsanwältin in der Nürnberger Kanzlei Zäh Rechtsanwälte, wundert sich. Nicht darüber, dass ihre Mandantin Frau T. eine Erinnerungslücke hat und nicht mehr beschreiben kann, was sich damals im Zimmer mit dem Pfarrer zugetragen hat; das kommt häufig vor bei traumatisierten Menschen. Nein, sie wundert sich über die Schlussfolgerungen des Voruntersuchungsführers nach Aktenlage. „Welchen Grund sollte diese Frau haben, mehr als 40 Jahre später sich so etwas auszudenken und diesen Pfarrer anzuzeigen?“, fragt sie.
Bei Vorwürfen sexuellen Missbrauchs ist die Beweisführung häufig schwierig, weil es keine Tatzeugen gibt. Frau T. nennt in ihrer Schilderung zwar zwei mögliche Zeugen, ihre Mutter und ihre kleine Schwester. Aber die Mutter lebt nicht mehr, und die Schwester gibt an, keine Erinnerung mehr an das abendliche Gespräch zu haben. Das hat Frau T. dem Bistum so mitgeteilt.
Aber, sagt Antje Steiner, die Rechtsanwältin: Die Schilderungen von Frau T. beschränken sich ja nicht nur auf Vermutungen. Frau T. nennt einen konkreten Ort, ein Datum, einen Namen. Sie liefert Details: die erste Beichte vor der Erstkommunion, den Kindergarten, die Beschreibung des Raums. „Man hätte doch wenigstens die objektiv überprüfbaren Tatsachenschilderungen ermitteln müssen, bevor man von Fiktion spricht“, sagt sie.
Der Voruntersuchungsführer hat im zuständigen Offizialat nachgefragt, wie denn 1977 in dem kleinen Dorf die Vorbereitung auf die Erstkommunion ausgesehen habe. Die Antwort fiel kurz aus: „Leider mussten wir feststellen, dass vor 1978 keine Listen der Erstkommunionsjahrgänge geführt wurden. Die erste überlieferte Liste ist die von der Erstkommunion am 21. Mai 1978 (…).“ In seinem Bericht hält der Voruntersuchungsführer fest: „Warum die erste Beichte in einem Kindergarten abgenommen wurde, kann heute nicht mehr geklärt werden und ist auch ohne Belang.“
„Ich habe keine Worte dafür“, wundert sich Anwältin Steiner.
Die Wissenschaft
Ein fünfköpfiges Team der Universität Münster, größtenteils Historiker, hat im Oktober 2019 begonnen, sexuellen Missbrauch im Bistum seit 1945 zu erforschen. In Auftrag gegeben und finanziert hat die Studie das Bistum – wie andere Bistümer auch sah sich Münster nach zahlreichen Missbrauchsvorwürfen und anhaltender Kritik in der Pflicht, die Dimension der Taten und mögliches Fehlverhalten von Kirchenverantwortlichen extern aufarbeiten zu lassen. Frau T. wendet sich 2021 deshalb auch an die Universität und schildert ihre Erinnerung. Der Leiter der Forschungsgruppe antwortet per E-Mail: „Wir werden die Informationen in unser Forschungsprojekt einfließen lassen“.
Als die Forscher im Juni 2022 ihre Studie veröffentlichen, haben sie 610 Missbrauchsbetroffene und 196 beschuldigte Kleriker ermittelt. „Die Diskrepanz zwischen dem so gewonnenen Hellfeld und dem Dunkelfeld der Taten, die unentdeckt bleiben, ist jedoch groß“, schreiben die Wissenschaftler. Die Zahl der „tatsächlichen Taten“ schätzen sie „auf acht- bis zehnmal höher als die, die hier nachgewiesen sind“. Im Mittelpunkt ihrer Studie stehen zwölf ausführliche Fallstudien.
Der Fall T. wurde nicht zur Fallstudie, Frau T. bleibt im Dunkelfeld.

Der Beschuldigte
Der Pfarrer ist ein alter Mann von mittlerweile 94 Jahren. Gleich im Februar 2021 sucht ihn der Weihbischof auf, um ihn über den Vorwurf zu informieren, der das Bistum erreicht hat; so schreibt es Ziffer 26 der „Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch“ vor. Der Weihbischof trägt dem Pfarrer auf, keine öffentlichen Gottesdienste mehr zu feiern. Der Pfarrer zeigt sich einverstanden, er sei altersbedingt ohnehin nicht mehr dazu in der Lage. Den Vorwurf selbst weise er aber „deutlich“ zurück, so hält es der Weihbischof in seinem kurzen Bericht fest.
Nach dem Gespräch mit dem Weihbischof sucht sich der Pfarrer einen Anwalt. Ein bekannter Strafverteidiger aus der Region übernimmt den Fall, er setzt ein Schreiben an die Anwältin von Frau T. auf. Darin finden sich Formulierungen wie „ungeheuerliche Behauptung“ und „unzutreffende Anschuldigungen“. Der Anwalt des Pfarrers schreibt, dass seinem Mandanten durch die „falschen Anschuldigungen“ „erhebliche Nachteile“ entstanden seien, etwa die Auflage, keine öffentlichen Gottesdienste mehr zu feiern. Sein Mandant sei durch „derart unrichtige Behauptungen psychisch sehr belastet“ worden.
Er deutet an, dass Frau T. an einer „krankhaften Störung“ leide.
Sein Schreiben schließt der Anwalt mit einer Ankündigung: Sollte Frau T. weiter an ihrer Behauptung festhalten, werde sich „die Einleitung zivil- und auch strafrechtlicher Schritte nicht vermeiden lassen“.
Wieder hört Frau T., dass ihre Aussagen unwahr seien. Und wie 44 Jahre zuvor von ihrer Mutter hört sie, dass sie schweigen soll.
Die Gemeinde
Frau T. will aber nicht mehr schweigen. Sie will sich auch nicht „einschüchtern“ lassen, so empfindet sie die Hinweise auf mögliche rechtliche Konsequenzen.
Wenn die Staatsanwaltschaft nicht ermittelt, wenn das Bistum von „Fiktion“ ausgeht, wenn die Universität keine weiteren Anhaltspunkte findet, dann bleibt ihr nur die Möglichkeit, selbst Belege und Zeugen zu suchen.
Sie schreibt einen „Brief an die Gemeinde“. In dem Brief schildert sie ihre Erinnerungen, sie nennt Ort und Zeit. Der Brief schließt: „Sollte es unter Ihnen Menschen geben, denen es ähnlich wie mir ergangen ist, bitte ich Sie, sich beim Interventionsbeauftragten des Bistums Münster, mit dem ich weiterhin in Kontakt stehe, zu melden.“ Sie hat gehört, dass es Fälle gab, in denen vergleichbare Briefe in der Kirche verlesen worden sind. Ihre Anwältin leitet den Brief an das Bistum weiter.
Der Inventionsbeauftragte antwortet. „Den Brief würden wir seitens des Bistums oder der Gemeinde in dieser Form nicht veröffentlichen“, schreibt er. „Es wäre sehr schnell klar, um welchen Priester es sich handelt. (…) Eine Verleumdungsklage gegen Ihre Mandantin, aber auch das Bistum wäre nicht auszuschließen.“
Die Medien
Frau T. nimmt Kontakt zur Lokalzeitung auf. Wenn die über den Fall berichtete, würden sich dann vielleicht weitere Opfer des Pfarrers melden? Oder Mitwisser? Wenigstens Zeitzeugen, die Erinnerungen an Frau T., den Pfarrer und die Erstkommunion 1977 haben?
Vor wenigen Wochen erst hatte die Zeitung nach einem anderen Missbrauchsvorwurf Schlagzeilen gemacht. Den Leiter der Lokalredaktion hatte ein Schreiben erreicht, in dem ein anonymer Absender Vorwürfe gegen einen längst verstorbenen Pfarrer erhob. Der Redakteur fragte beim Bistum nach, ob dort weitere Vorwürfe bekannt seien. Das Bistum bejahte dies. Es liege ein Vorwurf gegen den Pfarrer vor – von einem anderen Betroffenen, der von einer anderen Tat zu einer anderen Zeit berichtete.
Eine journalistische Grundregel besagt, dass eine Information veröffentlicht werden kann, wenn zwei voneinander unabhängige Quellen sie bestätigen. Diese zwei Quellen hatte der Redakteur jetzt im Fall des verstorbenen Pfarrers. Er veröffentlichte den Vorwurf, er nannte den Namen des beschuldigten Pfarrers. Nach der Veröffentlichung meldeten sich weitere Betroffene, die Missbrauch durch den Pfarrer in den 50er- und 60er-Jahren erlebt hatten. Einige hatten wie Frau T. jahrzehntelang geschwiegen und sprachen zum ersten Mal über die Taten.
Journalisten sprechen gern von einem Stein, den sie mit so einer Veröffentlichung ins Wasser werfen. Manchmal zieht so ein Steinwurf Kreise. Auf solche Kreise hofft auch Frau T.
Ihr Fall ist aber anders. Dem Redakteur liegt allein die Aussage von Frau T. vor, der Beschuldigte streitet die Tat ab. Der Journalist macht seinen Job, er recherchiert: Er spricht mit dem Bistum in Münster, mit dem Offizialat in Vechta, mit der Staatsanwaltschaft, mit den Historikern der Universität in Münster, mit der Betroffenen-Initiative im Bistum. Niemand kann ihm weitere Belege geben. Am Ende hat er noch immer nur eine einzige Quelle: die Aussage von Frau T. „Das ist mir zu dünn“, sagt er. Er entscheidet sich gegen eine Veröffentlichung, er wirft keinen Stein ins Wasser. Zu groß erscheint ihm die Gefahr, dass ihn die Wellen selbst treffen.
Aus Sicht des Deutschen Journalistenverbands (DJV), Landesverband Niedersachsen, hat der Lokalredakteur presserechtlich richtig entschieden. Für eine identifizierende Verdachtsberichterstattung gelten strenge Regeln, eine davon lautet, dass ein Mindestbestand an Beweistatsachen erforderlich ist. „Bei einer fehlenden Tatsachengrundlage überwiegt das Schutzgut Persönlichkeitsrecht“, sagt Ursula Meschede, Justiziarin des DJV in Hannover.
Das Persönlichkeitsrecht des beschuldigten Pfarrers ist auch der Grund dafür, warum in diesem Text weder der Name des Pfarrers noch der Ort oder der Titel der Zeitung genannt werden.
Frau T.
Bei unserem zweiten Treffen in Nürnberg im Sommer 2022 ist Frau T. wütend. Sie hat wieder einen längeren Klinikaufenthalt hinter sich; immer wieder verbringt sie Zeit damit, ihre Traumatisierung therapeutisch behandeln zu lassen. Ihren erlernten Beruf als Krankenschwester kann sie nicht mehr ausüben. Wie bei allen Treffen ist ihr Ehemann dabei; ohne ihn würde sie das alles nicht schaffen, sagt sie.
Sie hat mittlerweile den Schlussbericht des Voruntersuchungsführers gelesen mit dem Wort „Fiktion“. „Sprachlos“ mache sie das, sagt sie, „mir stockt der Atem“. Sie hat den Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft gesehen und den Begriff „vermuteter Vorfall“. Sie weiß, dass die Gemeinde ihren Brief nicht lesen und die Zeitung keinen Artikel veröffentlichen wird. Der Weg in die Öffentlichkeit ist ihr verstellt – es sei denn, sie würde das rechtliche Risiko einer Verleumdungsklage auf sich nehmen. Schon jetzt tragen sie und ihr Mann eine vierstellige Summe an Anwaltskosten, sagt sie.
Herr T., ihr Ehemann, berichtet, er habe sich neulich den Podcast des Bistums Münster angehört, „Kannste glauben“ lautet der Titel. Peter Frings war dort zu Gast, der Interventionsbeauftragte, es ging um das Thema Missbrauch. Frings sagt in dem Podcast, dass er den Opfern glaube. Herr T. sagt, seiner Frau glaube das Bistum aber nicht.
Das Bistum, zum dritten Mal
Münster im Sommer 2022. Hinter dem Dom, gleich neben dem Kreuzgang, ist im Haus des Kirchlichen Arbeitsgerichts die Interventionsstelle untergebracht. Im Besprechungsraum sitzt unter einem großen Wandkreuz Peter Frings, laut Internetseite weisungsunabhängiger Interventionsbeauftragter des Bistums. Frings, 64 Jahre alt, Jurist und Katholik, stammt vom Niederrhein und sagt Sätze wie: „Ich bin nicht angestellt, um eine Imagekampagne der Kirche zu starten.“ Seit drei Jahren leitet er nun die Interventionsstelle – eine Stelle, die es vorher nicht gab im Bistum. Im Podcast „Kannste glauben“ sagt er: „Mir kann noch nicht mal der Bischof was sagen.“
Was glaubt der Interventionsbeauftragte, wenn sich jemand wie Hedwig T. an ihn wendet? „Warum sollte jemand auf die Kirche zugehen und so etwas Schlimmes aus seinem Leben erzählen?“, fragt Frings zurück. „Ich gehe davon aus, dass so jemand einen Grund dafür hat.“
Früher, sagt Frings, habe sich die Kirche schützend vor die Täter gestellt. Heute sagt Frings: „Ich bin nicht dafür da, Schaden von den Beschuldigten abzuhalten.“ Er verweist darauf, dass er Frau T. Akteneinsicht ermöglicht habe – ein datenschutzrechtlich immer noch kompliziertes Thema; im Mai 2023 plant er ein Rechtsforum zu dem Thema in Münster. Er verweist auf die Möglichkeit für Missbrauchsbetroffene, „materielle Leistungen in Anerkennung des Leids“ zu beantragen. Er verweist darauf, dass das Bistum die Kosten für eine anwaltliche Beratung übernehme; auch einen Teil der Anwaltskosten von Frau T. trägt das Bistum.
Aber Frings sagt auch, dass ihn Fälle wie der von Frau T. „ratlos“ machen. „Was können wir tun, ohne den Beschuldigten öffentlich vorzuverurteilen? Wir können nicht in die Gemeinde gehen und dort fragen: Wer weiß was? Dann riskieren wir eine Verleumdungsklage!“ Deshalb rate er den Betroffenen, sich unbedingt einen Anwalt zu nehmen, „um so etwas wie Waffengleichheit zu schaffen“. Von guten Opferanwälten erwarte er dann aber auch, dass sie ihren Mandanten sagen, was in so einem Verfahren auf sie zukomme und wann ihre rechtlichen Möglichkeiten erschöpft seien.
Aber bei allen Zweifeln und fehlenden Belegen, bei allen Vorgaben zu Persönlichkeitsrecht oder Datenschutz – muss nicht irgendjemand aufklären, was damals geschehen ist? Muss nicht irgendwer Frau T. helfen, Antworten auf ihre Fragen zu finden?
Frings kennt die Kritik an der Voruntersuchung im Auftrag des Bistums. Die Zweifel an der Ernsthaftigkeit kirchlicher Ermittlungen generell. Den immer wieder erhobenen Vorwurf der Parteilichkeit. Den vorwurfsvollen Satz „Ihr macht das ja alles selbst!“ Ja, sagt er, das sei richtig, „wir machen das alles selbst! Aber außer uns macht keiner was!“
Auch das ist richtig.
Die Betroffenen-Initiative
Dr. Hans Jürgen Hilling, 56 Jahre alt, Wirtschaftsanwalt und Partner einer renommierten Hamburger Anwaltssozietät, erlebte als Jugendlicher selbst sexualisierte Gewalt durch einen Pfarrer im Bistum Münster. Nach 35 Jahren Schweigen machte er den Übergriff 2019 öffentlich. Seither sieht er seine Rolle darin, dem Bistum mit seiner juristischen Erfahrung „als ziemlich starke Persönlichkeit“ gegenüberzutreten, wie er einmal in einem Interview sagte. Er engagiert sich in der Betroffenen-Initiative, er berät Opfer, führt immer wieder harte Auseinandersetzungen mit Bistum und Bischof. Aber er billigt der Bistumsleitung ausdrücklich auch Lernwilligkeit und Lernfähigkeit zu.
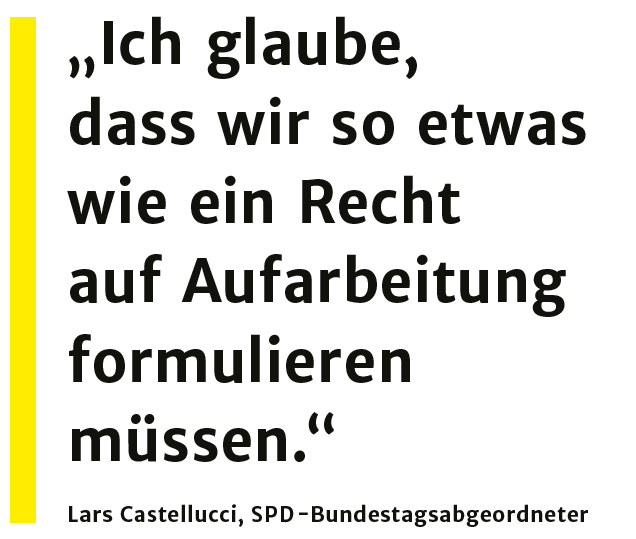
Hilling fragt mit Blick auf den Fall T.: Wenn nur die Kirche selbst ermittelt nach solch einem Missbrauchsvorwurf, müssten dann nicht wenigstens verbindliche Mindeststandards für die Voruntersuchung gelten? „Was muss so ein Voruntersuchungsführer konkret machen, und wer legt die Mindeststandards fest? Das Bistum etwa selbst?“, fragt Hilling weiter. „Wer überprüft eigentlich das Vorgehen des Voruntersuchungsführers und dessen Ergebnisse? Wem ist er rechenschaftspflichtig? Nur dem Bischof?“
Hilling hat noch mehr Fragen: „Wer ist überhaupt kompetent für so eine Voruntersuchung? Ein ehemaliger Kommissar, der kriminalistisch oder strafprozessual denkt und nach einem Anfangsverdacht sucht? Oder eher jemand, der wie ein Investigativjournalist denkt und arbeitet? Führt die Einsetzung von ehemaligen Polizisten nicht zu einer Verengung auf strafrechtlich relevante Sachverhalte? Die Untersuchung der Uni Münster hat doch gerade gezeigt, dass das Missbrauchs- und Vertuschungsgeschehen mit juristisch oder kriminalistisch verengten Fragestellungen weder erschöpfend erhellt noch verstanden werden kann!“
Wenn wie im Fall T. nach einer Voruntersuchung nur das Wort „Fiktion“ für die Betroffene bleibe, „dann ist das jedenfalls nicht befriedend“, sagt Hilling.
Der Politiker
An einem Vormittag im Frühsommer 2022 tritt Prof. Dr. Lars Castellucci, 48 Jahre alt, in der Malzfabrik in Berlin-Tempelhof ans Rednerpult. Castellucci, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Rhein-Neckar-Kreis, ist Gast einer Tagung der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs; er soll die Eröffnungsrede halten. Er sagt: „Es reicht nicht. Es geht nicht einfach so weiter wie bisher. Oder es geht noch 100 Jahre so weiter wie bisher.“
Castellucci hat ein Zehn-Punkte-Papier mit nach Berlin gebracht. Punkt neun lautet: „Niemand sollte mit seinem Anliegen auf die Organisation verwiesen bleiben, in deren Rahmen die Taten geschehen sind. Die Aufarbeitung von Einzelfällen braucht einen verbindlichen Rahmen. Mindestens braucht es eine unabhängige Clearingstelle.“
Wie könnte das aussehen? Wo könnte eine solche Stelle angesiedelt sein? Seine Gedanken seien noch nicht fertig gedacht, sagt Castellucci einige Wochen später am Telefon, es ist ein eiliges Gespräch zwischen zwei Terminen. „Aber ich glaube, dass wir so etwas wie ein Recht auf Aufarbeitung formulieren müssen.“
Ein verbindlicher Rahmen. Das Recht auf Akteneinsicht. Feste Fristen. Und, Punkt zehn seines Papiers: „Betroffene sind zu beteiligen, aber sie haben keine Verantwortung für das, was geschehen ist. Folglich sollten sie auch keine Verantwortung für die Aufarbeitung übertragen bekommen.“
Es sind Begegnungen mit Betroffenen, die ihn zu der Einsicht gebracht haben, „dass wir an dem Thema anders arbeiten müssen, als es bisher geschehen ist. Diese Ohnmacht, dieses Gegen-Wände-Rennen.“
Er freue sich, wenn Menschen seine Vorschläge weiterdenken. „Aber nicht mehr so arg lange“, sagt Castellucci am Telefon.
Die Wissenschaft, noch einmal
In der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sagt Prof. Dr. Klaus Große Kracht, 53 Jahre alt, Historiker mit Schwerpunkt Religionsgeschichte und Mitglied der Forschungsgruppe zum sexuellen Missbrauch im Bistum Münster: „Das Thema Missbrauch hat Ränder – ich will nicht sagen Ränder der Glaubwürdigkeit, sondern der Informationsdichte. Dem muss sich die Kirche stellen.“
Der Fall T. habe ihn nach der Anfrage 2021 lange gedanklich beschäftigt, sagt Große Kracht. Er fragte sich: Was kann man tun? Wie kann man in so einem Fall die Beweislast von den Schultern der Betroffenen nehmen?
Wenn der Staat nicht ermittelt, könnten möglicherweise Anhörungen ein Mittel sein, überlegte er: „respektvolle Hearings an verschiedenen Orten in einem geschlossenen Rahmen, als Substitut für eine Gerichtsverhandlung“. Er denkt an Beispiele wie die Wahrheitskommissionen nach dem Ende der Apartheid in Südafrika: Es ging dabei nicht um Bestrafung der Täter, es ging um Aufklärung, um Dokumentation, um Dialog, um Anerkennung von Leid. „Vielleicht ist das etwas, was auch den Betroffenen von sexuellem Missbrauch hilft“, sagt Große Kracht. „Und vielleicht ist das etwas, was jemand wie der beschuldigte Pfarrer über sich ergehen lassen muss.“ Die Kirche könnte den Rahmen schaffen und die Kosten tragen, die Betroffene könnte ihre Erinnerungen schildern, der Beschuldigte könnte Stellung nehmen und seine Erinnerung schildern, man könnte dokumentieren und „Anerkennung geben“.
Große Kracht sieht aber auch die Schwierigkeit solcher Anhörungen, solange jeder Missbrauchsvorwurf gesellschaftlich bereits einem Schuldspruch gleichkommt. Hilfreich wäre weniger „Skandalisierung“, so Große Kracht, vor allem in der Presse. „Wir haben in unserer Studie versucht zu vermeiden, Gerüchte in die Gemeinden zu tragen. Wir haben immer wieder gesehen, was es bedeutet, wenn sich ein Priester solchen Anschuldigungen ausgesetzt sah. Denn auch die Gläubigen in den betroffenen Pfarreien werden lernen müssen, dass sich nicht mehr alle Missbrauchsvorwürfe vollständig werden klären lassen.“
Die Gutachter
Dr. Ulrich Wastl hat keinen Zweifel. „Wir hätten in Deutschland bis zum heutigen Tag wohl kaum ein Missbrauchsgutachten, wenn es nicht die Presse gäbe“, sagt er. Der Rechtsanwalt sitzt in einem Besprechungsraum der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl in München, auf dem Tisch Konferenztechnik und Kaffee, an den Wänden Strafrecht, Zivilrecht, Kirchenrecht zwischen Buchdeckeln. Neben ihm sitzt sein Kollege Dr. Martin Pusch und sagt: „Es braucht Druck.“
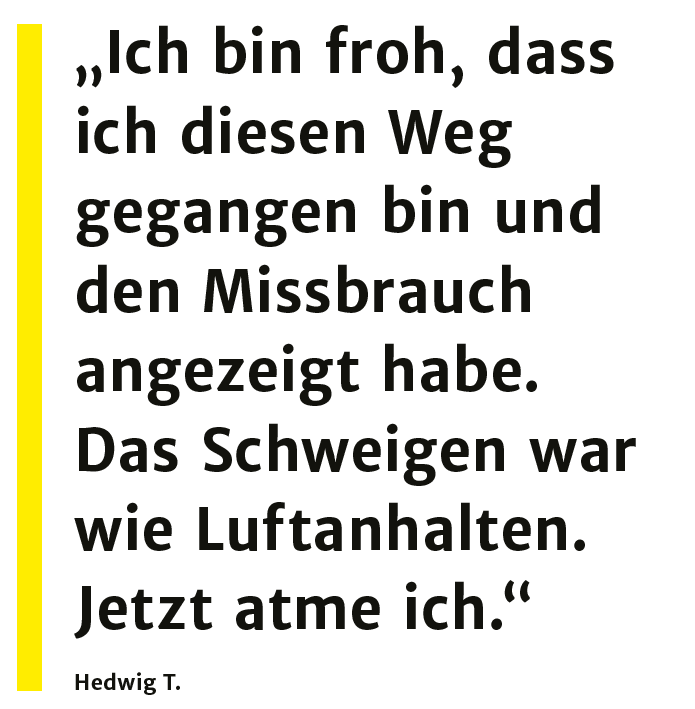
„Unbeliebte Aufklärer“, so hat die „Süddeutsche Zeitung“ einen Text über die Kanzlei überschrieben. Westpfahl Spilker Wastl hat Missbrauchsgutachten verfasst, die Schlagzeilen machten: für die Bistümer München-Freising, Köln, Aachen. In Fachvorträgen und Fachartikeln diskutieren die Anwälte der Kanzlei kritisch Fragen des Äußerungsrechts und des Persönlichkeitsrechts, weil beides immer wieder angebracht wird, um Verdachtsberichterstattung und ganze Gutachten zu verhindern. Oder zu Datenschutz und Archivrecht, weil es genutzt wird, um Akteneinsicht zu erschweren. Und immer wieder zum Problem der Glaubhaftigkeit von Opferzeugen. Die Anwälte sprechen von einer „tatsächlichen Unterlegenheit“ der Opfer im Bemühen um Aufarbeitung.
„Den Opfern wird immer erklärt, was nicht geht“, sagt Ulrich Wastl. Viel wichtiger ist aber doch die Frage: Was geht?
Die Anwälte haben für ihre Missbrauchsgutachten zahlreiche Akten durchforscht. „Die ,Smoking Gun‘ findet sich selten in der Akte“, sagt Martin Pusch. „Es mag sein, dass sich dort nichts findet“, sagt Wastl. „Aber wir sind doch immer wieder überrascht, was man dort so lesen kann.“ Er spricht von „kreativer Aktenführung“, Pusch hat immer wieder „Codewörter“ entdeckt.
Noch etwas ist den Anwälten aufgefallen: „Es finden sich vor Ort fast immer Leute, die etwas mitbekommen haben“, sagt Wastl. „Ich hänge der These an, dass es den Einmal-Täter nicht gibt.“
Deshalb hat er auch keinen Zweifel: Zur Antwortsuche muss man in die Gemeinden gehen. „Das wird viel zu wenig gemacht“, so Wastl.
In den Gemeinden müsse dann Folgendes geschehen:
- Man muss Opfer zusammenbringen.
- Dafür braucht man einen Raum, in dem sich die Opfer völlig geschützt fühlen und Stärke entwickeln können. „Der Raum darf nichts mit Kirche zu tun haben“, sagt Wastl.
- Man braucht unabhängige professionelle Unterstützung, am besten mit psychologischer Expertise.
So, sagt Wastl, können Opfer Vertrauen aufbauen. Kann sich eine Eigendynamik entwickeln. Kann ein Schneeballeffekt entstehen, der weitere Leute mit ihren Geschichten in den Raum holt.
Bloß: Wer organisiert das für Menschen wie Frau T.? In dem kleinen Dorf, in der zuständigen Kirchengemeinde weiß mehr als eineinhalb Jahre nach ihrer Anzeige immer noch niemand von dem Missbrauchsvorwurf.
„Mein Eindruck ist, dass den Menschen im ersten Schritt schon geholfen ist, wenn da jemand sitzt und sagt: Ich glaube Ihnen“, sagt Wastl.
Frau T., zum Schluss
In Nürnberg versteckt sich die Sonne hinter Altstadttürmen. Die nahe Lorenzkirche wirft lange Schatten, aber Frau T. erreichen sie nicht.
„Wenn jemand sich nach einem Autounfall nicht erinnern kann, sagt jeder: Ja klar, verständlich, das ist ein Selbstschutz“, sagt sie. „Beim Missbrauch aber wird das gegen das Opfer verwendet.“ Nur mühsam unterdrückt sie ihre Wut. „Missbrauchsopfer erleiden einen Totalschaden!“, sagt sie.
Frau T. hat bei der Kirche inzwischen einen Antrag auf „materielle Anerkennung des Leids“ gestellt, die Entscheidung steht aus. Ihre Anwältin hat Beschwerde gegen die Voruntersuchung des Bistums eingelegt.
In den vergangenen 22 Monaten hat niemand zu Frau T. gesagt: Ich glaube Ihnen. Im Gegenteil, man sagte und schrieb ihr immer wieder: Wir glauben Ihnen nicht.
Frau T. ringt um Worte. „Wer diesen Weg geht, muss neue Demütigungen und Verletzungen aushalten“, sagt sie. Aber sie sagt auch: „Ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und den Missbrauch angezeigt habe. Das Schweigen war wie Luftanhalten. Jetzt atme ich.“
Karsten Krogmann