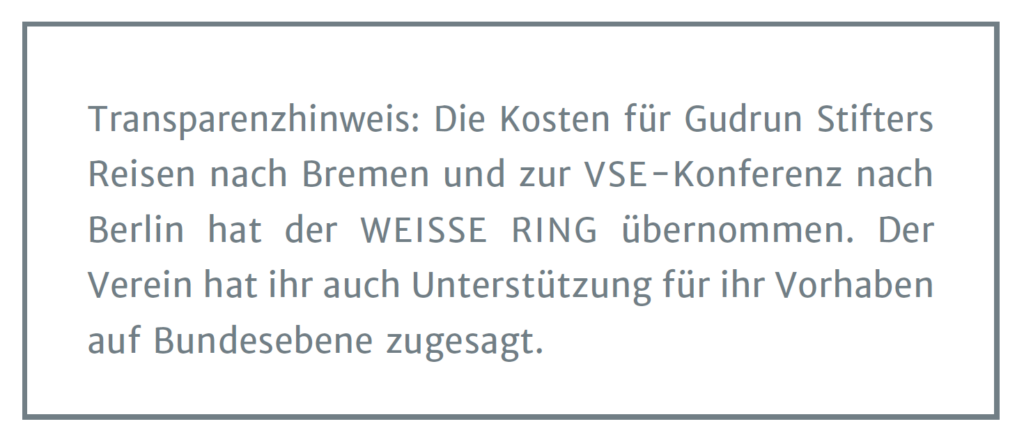Gudrun Stifter hat selbst erfahren müssen, wie der Staat Gewaltopfer allein lässt. Die Münchenerin nimmt das nicht hin – sie kämpft in ganz Deutschland für eine bessere Umsetzung des Opferentschädigungsgesetzes (OEG). Um das zu erreichen, hat sie gemeinsam mit anderen in sämtlichen Bundesländern Petitionen eingereicht. Die Redaktion des WEISSEN RINGS hat die junge Frau mehr als ein halbes Jahr begleitet und dabei erlebt, wie sie sich auf der politischen Bühne immer weiter professionalisierte und erste Erfolge feierte, aber auch immer wieder Rückschläge hinnehmen musste.
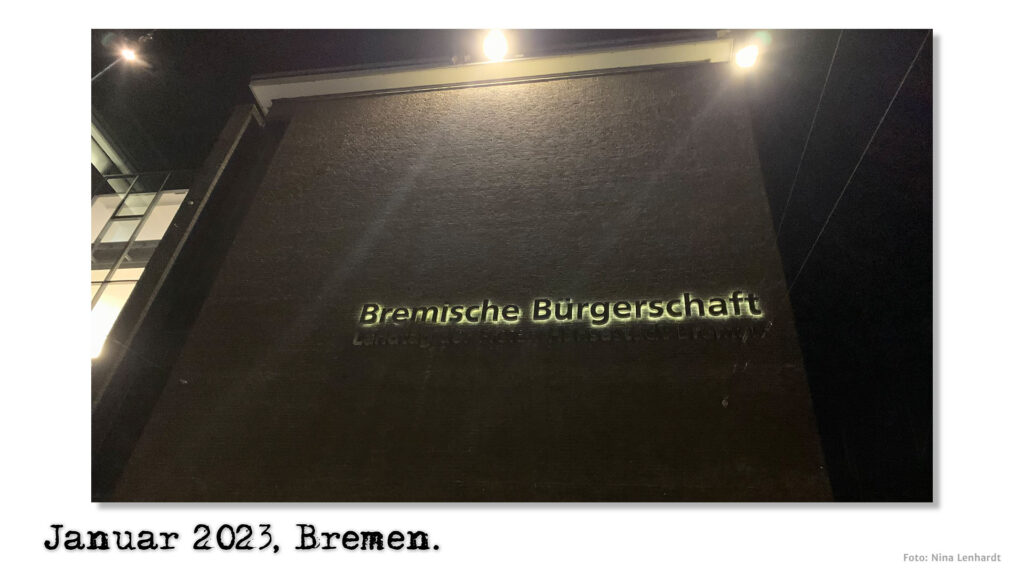
Es ist längst dunkel, vor dem Haus der Bremischen Bürgerschaft herrscht an diesem Freitagabend eisige Kälte, aber Gudrun Stifter scheint das alles gar nicht wahrzunehmen. Sie lächelt nicht, sie lacht, die Anspannung des Tages ist ihr sichtlich von den Schultern gefallen. 60 Minuten dauerte ihr Termin vor dem hiesigen Petitionsausschuss, viermal so lange wie eigentlich geplant nahm sich die Runde Zeit für das Anliegen der jungen Frau aus München: das Opferentschädigungsgesetz, kurz OEG, gerechter zu machen.
Voller Hoffnung war sie nach Bremen gefahren, sieben Seiten hatte sie in der Nacht noch geschrieben und kaum ein paar Stunden geschlafen. Gudrun Stifter wollte gut vorbereitet sein, es war schließlich das erste Mal, dass sie vor Politikern und Politikerinnen im Ausschuss sprechen konnte. Um diese dafür zu gewinnen, die Umsetzung eines Bundesgesetzes in dem kleinen hanseatischen Bundesland zu verbessern.
Gudrun Stifter ist keine Politikerin, keine Juristin, keine Lobbyistin. Sie ist ein einzelnes Gewaltopfer und sie ist eine Aktivistin, die sich nicht nur in Bremen eigeninitiativ mit ihrer „Petition L20-567“ für die Rechte von Betroffenen einsetzt – sondern mit Petitionen in ganz Deutschland. „Wenn ich es nicht mache, macht es keiner“, sagt sie.

Es gibt Menschen, deren Leben wie am Reißbrett gezeichnet verläuft: Karriere, Kinder, ein eigenes Haus, alle Träume erfüllend.
Gudrun Stifters Leben gehört nicht dazu.
Ihr Leben ist über Jahre hinweg immer wieder geprägt von Gewalt, als Zeugin, als Opfer. Traumata statt Träume. So wie an diesem Sommerabend im August 2021, als sie zufällig einem flüchtigen Bekannten begegnet, der die damals 27-Jährige mehrfach vergewaltigt. Heimlich gelingt es Stifter, WhatsApp-Nachrichten an ihre Mitbewohner zu schreiben; die müssten doch noch wach sein? Niemand reagiert. Irgendwann kann sie selbst den Notruf wählen, die Polizei befreit sie aus der Gewalt des Täters. Als dieser Monate später zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt wird, hat Gudrun Stifter fast alles verloren: ihre Ausbildung, ihr Zuhause, Freunde. Die Mitbewohner schmissen sie aus der WG, „weil die nichts mit der Kriminalpolizei zu tun haben wollten“, sagt sie. Zwischenzeitlich ist sie obdachlos, lässt sich aus Verzweiflung selbst in eine Klinik einweisen, kommt später bei Bekannten und einem Freund unter.
Obendrein erhält Stifter eine Rechnung von ihrer Krankenkasse über mehrere Hundert Euro: Sie müsse auch als Opfer die Laborkosten für alle Tests auf sexuell übertragbare Krankheiten selbst tragen. Ebenso für die „Pille danach“, um eine durch die Tat möglicherweise verursachte Schwangerschaft zu verhindern.
Sie ertrage einiges, sagt Stifter, „aber Ungerechtigkeit nicht“.
Sie recherchiert nächtelang, schreibt Briefe an die Krankenkasse und reicht eine Petition im bayerischen Landtag ein: Der Staat solle diese Kosten übernehmen und nicht auch noch den Opfern aufbürden. Ihre Hartnäckigkeit zahlt sich aus, mittlerweile beschäftigt sich der Bundestag mit dem Antrag, Zeitungen und das Fernsehen berichten über ihren Fall. Schließlich zahlt die Krankenkasse, teilt aber mit, dass es sich um eine „Einzelfallentscheidung“ handele.

Gudrun Stifter hat nach der Tat in ihrem Bundesland einen Antrag auf Opferentschädigung gestellt und merkt schnell: „Da ist ein dickes Fell nötig.“ Als die Redaktion des WEISSEN RINGS im Juni 2022 den „OEG-Report“ veröffentlicht, ist das für sie eine Initialzündung „zum richtigen Zeitpunkt“, wie sie später sagt.
Der Report belegt: Wer in Deutschland von einer Gewalttat betroffen ist, muss oft jahrelang um die Anerkennung seines Leids kämpfen. Die Recherche zeigt auch, dass der Staat bei der Umsetzung des eigentlich gut gemachten Opferentschädigungsgesetzes oftmals scheitert. Mehr noch: dass die Betroffenen die häufig jahrelangen Verfahren als retraumatisierend und zermürbend erleben. Nicht wenige geben irgendwann auf, zu belastend ist die Auseinandersetzung mit Behörden.
Stifter findet ihre Erfahrungen im „OEG-Report“ wieder, erfährt, dass sie nicht allein ist, dass es so viele andere gibt, denen es ähnlich geht. Sie will das, diese „himmelschreiende Ungerechtigkeit“, nicht hinnehmen. Sie will zeigen, dass hinter jeder Zahl, hinter jedem abgelehnten OEG-Antrag ein Schicksal steht. Am besten könnte das gelingen mit Petitionen in allen Bundesländern, denn die sind verantwortlich für die Umsetzung des OEG in der Praxis.
Lange Nächte am Schreibtisch
Was treibt sie an? Sie habe ein empathisches Herz, antwortet die junge Frau, „ich bin tatsächlich ein sehr altruistischer Mensch“.
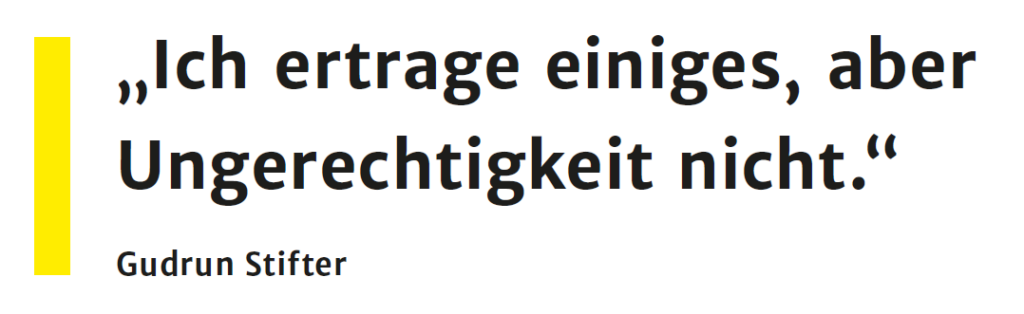
Nächtelang quält sie, die sich selbst als Nachteule bezeichnet, sich also am Schreibtisch in ihrer Wohnung, in der sie mittlerweile lebt, durch Gesetzestexte, studiert statistische Auswertungen, tippt erste Bausteine für Petitionen in ihren Laptop, erstellt die Webseite petitionen-oeg.de und richtet Social-Media-Kanäle ein. Sie vernetzt sich virtuell mit anderen Betroffenen, tauscht sich mit Experten aus, darunter Jörg Michael Fegert, einem Psychotherapeuten und Hochschulprofessor, oder mit Münchener Landespolitikerinnen.
Sie erinnert sich, wie schockiert Vertreterinnen und Vertreter von FDP und Grünen gewesen seien, als sie ihnen das erste Mal über die Probleme bei der Umsetzung des OEG berichtete: „Die Missstände waren ihnen nicht bekannt.“ Stifter tat es gut, wahrgenommen zu werden, „dass jemand zugehört hat, dass meine Aussagen und die Fakten ernst genommen wurden. Dass mir geglaubt und ich unterstützt wurde. Das gab mir Auftrieb, weiterzumachen“.
Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern reicht Stifter schließlich Petitionen in allen deutschen Landtagen ein. Der Tag ist sorgfältig ausgewählt: Die Aktion startet am 2. Oktober, dem internationalen Tag der Gewaltlosigkeit. Und Mahatma Gandhis Geburtstag, wie Gudrun Stifter auf ihrer Homepage schreibt.
Fünf Ordner voller Unterlagen
Die Reaktionen in Form von Einladungen zu Petitions- und Sozialausschüssen in mehreren Bundesländern lassen nicht lange auf sich warten. Stifter versucht, jeden der Termine wahrzunehmen, reist von frühmorgens bis spät in die Nacht quer durch die Republik.
Wie groß das alles werden würde, das habe sie damals „nie geahnt“, wird sie rund ein Jahr später sagen. Und auch nicht, wie anstrengend das werden würde.
Für die junge Frau bricht nach dem Einreichen der Petitionen eine Zeit an, in der sie in wenigen Monaten fünf Ordner mit Petitionsvorlagen, Anträgen, Behörden-Antworten, Rechtfertigungen und Einladungen füllen wird. In der sie eine Homepage ständig aktualisieren wird, einen Instagram-Kanal befüllen und auf Community-Fragen in einer Facebook-Gruppe antworten wird. In der sie Medien Interviews geben, Mails an Wissenschaftler schreiben und Telefonate mit Politikerinnen führen wird.
Eine Zeit, in der Gudrun Stifter von einer Betroffenen zur Projektmanagerin, Pressesprecherin, Ansprechpartnerin und Fachreferentin in Personalunion werden wird. Und dabei zwischen Euphorie und Resignation pendeln wird.

Als der Vorsitzende des Petitionsausschusses Claas Rohmeyer (CDU) erwähnt, dass Gudrun Stifter extra von München nach Bremen gereist ist, wird anerkennend auf die Tische geklopft. Es ist ein Freitagnachmittag, die Politikerinnen und Politiker sitzen hier ehrenamtlich, haben gerade eine lange Anhörung hinter sich, Tablets und Smartphones werden bedient, Unterlagen durchgeblättert, gelangweilt, ermüdet wirkt das zum Teil. Stifter, aufgeregt, aber sortiert, legt los: „Ich bin selbst Opfer von zwei Verbrechen geworden.“ Da halten die meisten inne, horchen auf, hören von da an aufmerksamer zu.

25 Minuten, so lange braucht die 29-Jährige, so lange darf sie auch sprechen. Danach nimmt der Leiter des Versorgungsamts Stellung. Ein Wahnsinnsthema sei das, „das sind dicke Bretter, die Sie da bohren“. Er verstehe ihre Ansätze und teile die Kritik des WEISSEN RINGS, auf die sie Bezug nimmt. Es stimme: Das OEG sei bundesweit wenig bekannt, das sei die Ursache für die niedrige Antragsquote, „das kann nicht sein“. Dann zählt er auf, was auf Bundesebene gerade passiere. „Die Verfahren sind belastend für die Opfer, auch wenn wir versuchen, sie sensibel zu gestalten.“ Der Gesetzgeber sehe vor, dass die Opfer eine Nachweispflicht haben, das sei die Ursache dafür, dass es wenige Anerkennungen und viele Rückzieher gebe. Es folgen Fragen der Ausschussmitglieder. Dann kündigt der Vorsitzende an, eine Stellungnahme des Landesopferschutzbeauftragten einzuholen.
Nach einer Stunde steht Gudrun Stifter also draußen in der Kälte. Der Ausschussvorsitzende kommt dazu, sagt, sie habe ihnen das Feld „sehr eindrucksvoll nahegebracht“. Zwar sei im Mai Wahl und es werde dann eine neue Zusammensetzung im Ausschuss geben. Aber das Thema werde der parlamentarischen Arbeit erhalten bleiben, versichert er und unterstreicht: „Das ist eine große politische Herausforderung.“
„Ich muss immer noch tief durchatmen.“ Stifter hatte mit Ablehnung gerechnet, jetzt ist sie „überwältigt“. Davon, dass sie so lange das Wort hatte. Von der Zugewandtheit der Ausschussangehörigen. Vom verständnisvollen Auftreten des Amtsleiters. Von der Kontaktaufnahme von Mustafa Öztürk (Grüne), der ihr Anliegen auf Bundesebene heben will. Die Reise in den Norden hat sich gelohnt.

Während sich eine pechschwarze Wolkenwand über das prachtvolle Maximilianeum schiebt, den altehrwürdigen Sitz des Bayerischen Landtags, pfeift der Wind durch die Gänge im Südgebäude. In Saal S401, in dem der Sozialausschuss tagt, hat Gudrun Stifter auf der vordersten Bank im Zuschauerbereich Platz genommen. Anders als zwei Monate zuvor in Bremen, ist sie diesmal nicht allein gekommen. Neben ihr sitzen
… Anne C., die vergeblich Gerechtigkeit für ihren Sohn David beim Freistaat eingefordert hatte. David war ein Gewaltopfer, das nach langem Kampf um Anerkennung nach dem OEG „nicht mehr konnte“, wie seine Mutter sagt, und sich das Leben nahm.
… Monica Gomes, die nach eigenen Worten ständige Retraumatisierungen erleidet durch die Schriftwechsel mit dem Amt, das ihren OEG-Antrag prüft. Das Öffnen des Briefkastens ist für sie längst unerträglich geworden.
… Wolfgang, Monicas Lebensgefährte, der vor Sitzungsbeginn noch DIN A4 große Zettel verteilt, mit der Überschrift: „Das OEG-Verfahren: ein deutscher Skandal.“
… Frau A., die jahrelang mit den Behörden um die Anerkennung ihres OEG-Antrags kämpfen musste.
Verhandelt wird an diesem Donnerstagmorgen der Antrag „Drucksache 18/26435: Wirksamkeit für das Opferentschädigungsgesetz (OEG) erhöhen: Betroffenen endlich gerecht werden“. Auf drei Seiten haben Landtagsabgeordnete von FDP, Grünen und SPD – im Bund stellen die Parteien die Regierung, in Bayern die Opposition – die Forderungen von Gudrun Stifter aufgegriffen, haben bei der Ausarbeitung des Antrags eng mit ihr zusammengearbeitet. Für Stifter ist das eine zuvor „unvorstellbare, große Ehre“.
Nur: Wirklich gerecht wird die Diskussion dem Anliegen der Betroffenen nicht, ist sich das Quintett aus der ersten Reihe später einig. Über die, um die es in dieser Geschichte geht, sei zwar gesprochen worden, aber nicht mit ihnen. „Das hat mich, ehrlich gesagt, sehr traurig gemacht“, sagt Monica Gomes. Sie habe sich wie Luft gefühlt, „obwohl die Abgeordneten einen natürlich gesehen haben“.

„Die Petitionen gehen unter die Haut.“
Auch Gudrun Stifter macht kein Geheimnis daraus, wie gern sie beim verbalen Schlagabtausch mit CSU, Freien Wählern und AfD mitgemischt und ihr Anliegen persönlich präsentiert hätte. So wie in Bremen. Weil sie weiß, dass Politikerinnen und Politiker Opfern eher zuhören als der Opposition. Dabei hatten die Abgeordneten Julika Sandt (FDP) und Kerstin Celina (Grüne) alle Punkte vorgetragen, die Stifter selbst in ihren Petitionen nennt.
Die Politikerinnen erzählen die Geschichten von Betroffenen aus ganz Deutschland. Menschen wie Alexei Kreis, der nach einer Schlägerei vor einer Diskothek zum Pflegefall wurde und dessen Familie Jahre auf Anerkennung des OEG-Antrags warten musste, oder Matthias Corssen, der von einem Krankenpfleger fast totgespritzt wurde und dem es mit der Bürokratie anschließend ähnlich erging. Es werden Statistiken und Recherchen des WEISSEN RINGS zitiert, die die sehr unterschiedliche Praxis bei der Umsetzung des OEG in den Bundesländern offenbaren. Die Abgeordneten untermauern damit ihre Forderungen, die auch in Stifters Petitionen stehen:
- Schaffung einer externen und unabhängigen Monitoringstelle für die Umsetzung des OEG und des Sozialgesetzbuches (SGB) XIV.
- Schaffung einer unabhängigen Beschwerdestelle für Gewaltopfer und Angehörige von Opfern von Mord- sowie Tötungsdelikten.
- Start einer Informations- und Aufklärungskampagne über die Ansprüche und Leistungen nach dem OEG und des SGB XIV.
CSU, Freie Wähler und AfD beeindrucken die Schilderungen und Zahlen nicht. Sie argumentieren trocken dagegen: Im SGB XIV, das 2024 das OEG ablösen wird, sei eine bundesweite Evaluierung ja schon vorgesehen. Außerdem gebe es bereits ein ausreichendes, umfassendes Hilfsnetzwerk für Betroffene und der bisherige Rechtsweg sei ausreichend.
„Wir hätten dies in wenigen Sätzen widerlegen können“, sagt Gudrun Stifter. Die Diskussion sei für sie „nahezu unerträglich“ gewesen. Nicht nur, weil einige Politikerinnen und Politiker „abgelenkt“ gewirkt hätten. Die „negativen Erfahrungen, die Schwierigkeiten mit dem Rechtssystem, die erlittenen Schäden und so weiter“ seien ihnen, den Betroffenen, abgesprochen worden. „Sie haben sich nicht mit den Petitionen und Hintergründen befasst, oder damit, dass das Gesetz in der Umsetzung scheitert. Sie verstehen es nicht. Und sie befassen sich damit nicht. Das macht mich wütend“, sagt Stifter. Kurz lächelt sie verlegen.

„CSU, Freie Wähler und AfD haben den Kern des Antrags nicht verstanden.“
Im nächsten Moment schaut sie wieder ernst: Eine Vertreterin des Staatsministeriums hatte als weiteres Gegenargument angeführt, eine Beschwerdestelle sei ja auch belastend für Gewaltopfer. „Das finde ich unglaublich: Wenn wir das nicht wollen würden, würden wir es ja nicht fordern.“ Für Stifter ist das nichts anderes als „Gaslighting“, eine Form gezielter Manipulation, mit der eine andere Person derart verunsichert wird, dass sie an ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln beginnt.
Dass der Antrag von FDP, SPD und Grünen ebenso wie die unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochenen Einzelpetitionen schließlich abgelehnt werden, überrascht die Petenten nicht. Enttäuscht sind sie trotzdem.

„Guten Tag, Gudrun Stifter mein Name“, stellt sich die Frau mit dem blonden Pferdeschwanz vor, lächelt, ist aber merklich aufgeregt. „Ich bin die Initiatorin einer deutschlandweiten Petitionsaktion von Gewaltopfern.“
Wenn Politikerinnen und Politiker öffentlich auftreten, etwa bei Bürgerdialogen oder Fachveranstaltungen, können sie nicht oder zumindest nur schwer ausweichen. Das erfährt auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) an diesem ersten Samstag im April, an dem er sich bei einer 24-Stunden-Diskussion des Vereins „Fortschritt, Vision, Diskurs“ Fragen zum Thema Inklusion stellen lässt.
Stifter weiß, dass der Landeschef erst ein paar Monate zuvor bei einer Podiumsdiskussion des WEISSEN RINGS vor rund 300 Menschen versprochen hatte, das Thema OEG in Sachsen zu evaluieren und bundesweit auf die Tagesordnung der Ministerpräsidentenkonferenz im Jahr 2024 zu setzen. Sie will, dass Kretschmer dieses Versprechen nicht vergisst und auch wirklich Wort hält. Dafür ist sie von München in die sächsische Landeshauptstadt gereist – für eine Minute und 44 Sekunden Redezeit.
„Was haben Sie explizit geplant?“
Sie befasse sich mit „Inklusion in einem etwas weiteren Bereich“, sagt sie augenzwinkernd, eben dem OEG, und trägt ihre Forderungen vor. Unterstützung erhalte sie unter anderem vom Dachverband der Opferschutzorganisationen in Europa, Victim Support Europe (VSE). Der sei ebenfalls der Ansicht, dass auch mit der Reform des Gesetzes im Jahr 2024 die „qualitative und quantitative Evaluation nicht ausreichen werde“.
Die 29-Jährige streicht sich durch das Haar, sie wirkt nervös, löst immer wieder die Hände voneinander, um sie kurz darauf wieder ineinander zu legen. „Was haben Sie explizit geplant, um die Evaluation zu ermöglichen und gegebenenfalls auch die Partizipation von Betroffenen und Experten wie Anwälten, Ärzten …?“ Kretschmer lässt Stifter nicht ausreden, unterbricht sie mit seiner wenig konkreten Antwort. Er habe erst letztens wieder mit dem sächsischen Landesvorsitzenden des WEISSEN RINGS über das OEG gesprochen. Er habe ja versprochen, dass Sachsen sich dort anders aufstellen werde, Beweislastumkehr und so, man wolle da schon etwas erreichen, sagt der Politiker. Und: „Ich teilte die Interessen und die Haltung, die Sie vermitteln, und glaube, dass man da vieles besser machen kann.“
„Vielen Dank“, sagt Gudrun Stifter und strahlt.
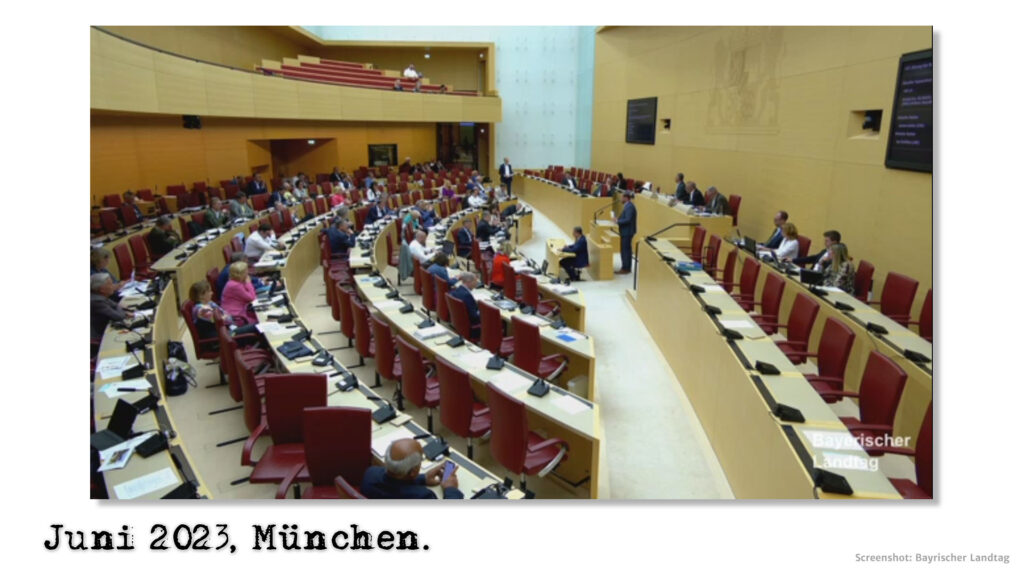
Gudrun Stifter weiß, was jetzt kommt.
Es ist kurz vor Mitternacht und der Bayerische Landtag nur noch gut zur Hälfte gefüllt, als die Debatte um den 13. Tagesordnungspunkt beginnt und Stifter, die auf den Rängen oberhalb des Plenums sitzt, ein „Déjà-vu“ erlebt: Dieselben Rednerinnen und Redner tauschen dieselben Argumente zur Wirksamkeit des Opferentschädigungsgesetzes aus, wie schon Monate zuvor ein paar Meter weiter im Saal S401 im Südgebäude. Die FDP konnte den Antrag trotz Ablehnung im Sozialausschuss in den Landtag einbringen.
Aber auch diese Abstimmung endet so wie die im März: Die Mehrheit ist dagegen.
Noch im Plenum nimmt die Grünen-Politikerin Kerstin Celina ein Selfie auf und postet es auf Instagram, schreibt dazu trotzig: „Dann ändern wir es halt im Bund. Danke Ampel, schon im Voraus.“
Die Uhr zeigt 5 nach 12 an. „Wie passend”, kommentiert Stifter. Was sie meint: Aus Sicht der Betroffenen ist es allerhöchste Zeit, dass sich etwas ändert.

„Noch mehr als eine Stunde Zeit“, stellt Stifter an einem Mittwoch um kurz vor 10 Uhr fest, als sie auf den grauen Magdeburger Bahnhofsvorplatz tritt. „So viel Zeit habe ich sonst nie“, sagt sie und lacht. Sie sieht erschöpft aus. Seit kurz nach vier Uhr in der Früh ist die junge Frau schon unterwegs, viel geschlafen hatte sie schon die Nacht zuvor nicht. Anders als vor einem halben Jahr in Bremen, muss sie den heutigen Termin in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts aber nicht mehr vorbereiten, sie weiß genau, was sie sagen wird.
Um 11:20 Uhr soll sie sich beim Landtag anmelden, der Weg führt durch die Altstadt, vorbei am Faunbrunnen, hin zur exzentrischen „Green Citadel“ von Friedensreich Hundertwasser. Ein paar Schritte weiter liegt das weniger spektakuläre, aber doch eindrucksvolle Landtagsgebäude, das früher einmal als Sitz einer Ingenieursschule fungierte.
Vorbei, bevor es begonnen hat?
Drinnen tauscht Stifter ihren Personalausweis gegen einen gelben Tagesausweis und postet das obligatorische Selfie vor den Landesflaggen auf Instagram, so wie sie es in jeder Landeshauptstadt macht, um ihre Follower in den Sozialen Medien mitzunehmen.
„Wir hatten hier schon ähnliche Anträge“, sagt die Vorsitzende des Petitionsausschusses ein paar Minuten später. Sie meint die OEG-Petitionen von Stifters Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die wenige Monate zuvor am selben Ort besprochen und zur juristischen Prüfung weitergegeben wurden. Da die Einordnung des Rechtsausschusses noch aussteht, schlägt eine Angehörige des Ausschusses vor, die heutige Besprechung zu verschieben.
Gudrun Stifter sitzt schräg rechts hinter der Frau, hat die Beine übereinandergeschlagen und presst die Hände ineinander. Ist es schon vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat? Und dafür der ganze Aufwand, das frühe Aufstehen, die lange und teure Fahrt, wo ihre finanzielle Situation eh schon schwierig ist? „Nein“, entscheidet die Vorsitzende und bittet Stifter in das Plenum.
Politiker hören ihr zu
Also legt die Aktivistin los. Sie referiert über die Probleme in OEG-Verfahren, zitiert routiniert Gesetze, belegt ihre Ausführungen aus dem Gedächtnis mit Zahlen und Studien. Einen Spickzettel wie in Bremen benötigt sie nicht mehr. Aus der einzelnen Betroffenen Gudrun Stifter aus Süddeutschland ohne Erfahrung auf dem politischen Parkett, die im Januar sagte, es koste sie Überwindung, in der Öffentlichkeit zu stehen, ist in den vergangenen Monaten eine erfahrene Kämpferin für die Belange von Gewaltopfern geworden.
Dass hier ein Opfer Opferinteressen vertreten kann, wirkt: Anders als im März in München hören die Ausschussangehörigen aufmerksam zu, stellen Nachfragen.
Auch wenn die Abstimmung über den Antrag dann doch verschoben wird, bis die Empfehlung des Rechtsausschusses vorliegt, ist Stifter zufrieden. Gerade, als sie den Stuhl nach hinten rückt, um aufzustehen, dreht sich die Vorsitzende zu ihr und fragt neugierig. „Sie sind ja auch in anderen Bundesländern aktiv. Wie war da denn so die Resonanz?“
Gudrun Stifter schmunzelt und antwortet: „Sehr unterschiedlich!“

Manchmal sitze sie nachts vor dem Laptop und könne einfach nichts mehr schreiben, sagt Gudrun Stifter. Die letzten Monate seien sehr anstrengend gewesen. Und dann sind da noch die Ablehnungen ihrer Petitionen, in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg und Bayern. In anderen Ländern wie Bremen oder Sachsen-Anhalt steht die Entscheidung noch aus. Frustrierend sei das, sagt die Münchenerin.
Neulich hat Stifter bei Facebook eine Nachricht erhalten: Ihr Engagement hat die Angehörigen eines Mordopfers ermutigt, ihre Probleme mit dem OEG öffentlich zu machen. Stifter zieht Kraft aus Nachrichten wie diesen.
Die benötigt sie auch. Hier unterstützt sie die Uniklinik Ulm bei der Auswertung einer wissenschaftlichen Umfrage zu Gewaltopfern, dort plant sie den Schritt in Richtung Bundesebene. Und, und, und. Es bleibt noch viel zu tun für Gudrun Stifter.
Christian J. Ahlers und Nina Lenhardt