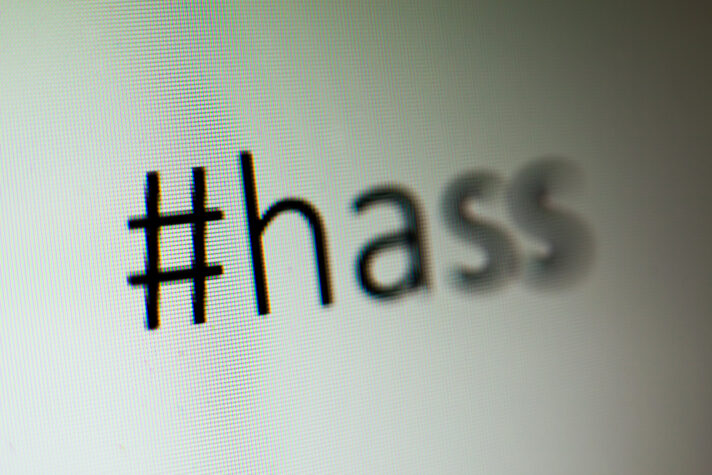Das Projekt
Die Studie mit dem Titel „Gewalt gegen Männer in Partnerschaften – Von der Scham zur Hilfe“ lief vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2023 und wurde projektiert von einem Team des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) e.V. in Hannover. Die WEISSER RING Stiftung hat die Untersuchung gefördert; zu ihren Zwecken gehört die Unterstützung von Forschung, insbesondere auf dem Gebiet der Kriminologie und Viktimologie.
Die Zielsetzung
Für Deutschland gab es bislang noch wenig empirisch belegte Erkenntnisse zu Männern, die in ihren (Ex-)Partnerschaften Opfer von Gewalt geworden sind. Das Projekt sollte daher zunächst wissenschaftlich belastbare Zahlen zu Gewalterfahrungen von Männern in Beziehungen hervorbringen. Zudem sollten Faktoren innerhalb der Partnerschaften untersucht werden, die diese Kriminalitätsform begünstigen, sowie psychische und gesellschaftliche Faktoren, die die Bewältigung des Erlebten beeinflussen.
➡ KFN-Studienleiter Schemmel: „Das fehlende Selbstverständnis als Opfer spielt eine zentrale Rolle“
Als drittes Ziel setzten sich die Forscher, mit der Studie einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Hilfelandschaft für die Betroffenen zu leisten. Begünstigt werden sollte dies durch die Anregung zur gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Studienthema.
Das Forschungsfeld
Untersucht wurde das sogenannte Dunkelfeld. Dabei liegt der Fokus nicht auf den Straftaten, die von den Opfern angezeigt wurden, oder den Fällen, in denen die Polizei ermittelt hat. Diese sind Delikte im „Hellfeld“ und in der offiziellen Polizeilichen Kriminalstatistik enthalten. Im Gegensatz dazu erforschten die KFN-Wissenschaftler Taten, von denen die Behörden nichts wissen; zum Beispiel, weil die Betroffenen aus Scham keine Anzeige erstattet haben oder sich selbst gar nicht als Opfer sehen.
Der Aufbau und die Teilnehmer
Der Forschungsbericht basiert auf drei Modulen, in denen Daten zu erwachsenen Betroffenen erhoben wurden:
1. Quantitatives Modul: Für eine Online-Befragung wurden 11.733 Männer im Alter zwischen 18 und 69 Jahren kontaktiert. Die Antworten von 1.209 Teilnehmern wurden für die Studie verwertet. Abgefragt wurden Erlebnisse mit physischer, psychischer, sexueller und digitaler Gewalt, Kontrollverhalten, Schutz- und Risikofaktoren, Folgen der Taten sowie Erfahrungen mit Hilfseinrichtungen und der Polizei.
2. Qualitatives Modul Interviews mit 16 betroffenen Männern sollten Aufschluss geben über Gewalterfahrungen und Dynamiken in der Paarbeziehung. Nur in einem Fall handelte es sich um eine homosexuelle Partnerschaft (der besseren Lesbarkeit wegen wird im Folgenden daher von Partnerinnen geschrieben). In den Gesprächen wurde zudem nach Reaktionen im sozialen Umfeld und Erfahrungen mit Unterstützungsangeboten gefragt, um Lücken in der Hilfsstruktur zu erkennen und Rückschlüsse auf den Umgang der Gesellschaft mit den Betroffenen zu erhalten.
3. Fachtag-Modul 19 Experten und Expertinnen, die sich haupt- oder nebenberuflich mit Partnerschaftsgewalt befassen, wurden die Ergebnisse aus den vorangegangenen Modulen vorgestellt. Es folgten verschiedene moderierte Diskussionsrunden, speziell ging es um die Beratungslandschaft, die Rolle der Polizei und den Einfluss von gesellschaftlich geprägten Männlichkeitsbildern.
Ausgewählte Ergebnisse
Laut der repräsentativen Online-Befragung haben rund 40 Prozent der Teilnehmer in ihrem Leben schon einmal psychische Gewalt erlebt. Auch Kontrollverhalten wurde häufig genannt (39 Prozent), etwas seltener körperliche Gewalt (30 Prozent). Sexuelle (5 Prozent) und digitale Gewalt (7 Prozent) kamen noch seltener zur Sprache. Generell wurde eher von weniger gravierenden Handlungen berichtet. Häufig traten mehrere Gewaltformen zusammen auf. Festgestellt wurde ein erheblicher „Victim-Offender-Overlap“: Mit rund 40 Prozent war mehr als ein Drittel der Befragten sowohl schon Täter als auch Opfer von Partnerschaftsgewalt. Von Folgen der Gewalterfahrung berichteten rund zwei Drittel der Männer.
Psychische Folgen wurden deutlich öfter genannt als körperliche Folgen, wobei diese meistens aus oberflächlichen Wunden bestanden. Die mit je 40 Prozent am häufigsten erwähnten Konsequenzen waren Stress, Anspannung, Gefühle der Machtlosigkeit und Erniedrigung. Auch Schlafstörungen und starke Angstgefühle wurden von den Teilnehmern thematisiert. Der häufigste Grund (59 Prozent), sich keine Hilfe zu holen: Die Gewalt wurde als „nicht so schlimm“ empfunden. Häufig gaben die Männer auch an (30 Prozent), die Angelegenheit selbst geregelt zu haben. Die häufigste Ursache für die Gewalt war Eifersucht (32 Prozent), an zweiter Stelle folgen Konflikte im Beziehungsalltag (fehlende gemeinsame Zeit, Haushaltsführung, Freizeitgestaltung, Sexualität, Finanzen), an dritter Stelle Kinder und danach Alkohol- oder Drogenkonsum.
In den Interviews erzählten alle der 16 Männer, dass sie psychische Gewalt erlebt hatten, etwa durch Abwertungen, Erniedrigungen, Drohungen, Beleidigungen, Schuldzuweisungen, Ignorieren oder Leugnen von Bedürfnissen sowie Kontrollverhalten. 14 Teilnehmer berichteten von körperlicher, drei von sexueller Gewalt. Die Interviewten beschrieben eine langsame und stetige Zunahme der Gewalt im Laufe der Beziehung, was bei ihnen zu einer Gewöhnung und Normalisierung führte und mit der Schwierigkeit verbunden war, sich selbst als Opfer wahrzunehmen. Konkrete Auslöser für Gewaltausbrüche konnten die Gesprächspartner nicht ausmachen, es gab jedoch Berichte über kritischen Alkohol- oder Drogenkonsum, Gewalterlebnisse in der Kindheit und psychische Erkrankungen bei den Partnerinnen.
Bei den Konsequenzen nannten die Männer psychische Folgen (Angst- und Schamgefühl, Störungen des Selbstbildes, Depressionen, suizidale Tendenzen) und körperliche (Verletzungen, Schlafstörungen, Panikattacken), einige erwähnten auch Selbstverletzungen. Der Umgang mit den gewalttätigen Situationen fiel sehr unterschiedlich aus, zum Beispiel wurden Flucht- und Schutzstrategien wie Gegenwehr beschrieben. Ursachen dafür, sich erst spät oder gar keine Unterstützung zu holen, waren für die Interviewten unter anderem fehlendes Wissen über die Angebote, generelle Skepsis oder Schamgefühl sowie fehlendes Angebot oder mangelnde Sensibilisierung und Wissen bei Behörden oder Institutionen wie Jugendamt, Arzt oder Polizei. Mehrere Teilnehmer erzählten, dass sie von ihren Partnerinnen bei Polizeieinsätzen oder Gerichtsprozessen fälschlicherweise als Täter beschuldigt worden waren.
Gemeinsame Kinder waren ein Grund, weshalb an den Partnerschaften festgehalten wurde. Streit um Sorge- und Umgangsrecht wurde häufig als sehr belastend wahrgenommen. Viele Väter fühlten sich zudem diskriminiert, weil ihre Bedürfnisse als Opfer und ihre Rechte als Väter durch die Behörden nicht gesehen worden seien. Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass es für Väter und ihre Kinder kaum Schutzangebote gebe. Gewünscht wurden mehr Anlaufstellen für gewaltbetroffene Männer. Laut dem Bericht fühlen sich die Gesprächspartner bis heute noch stark belastet von den Erfahrungen.
Die Diskussionen am Fachtag mündeten in acht Handlungsempfehlungen für die Praxis.
Die Grenzen
Für den Begriff „Gewalt“ gibt es unterschiedliche Definitionen. Die KFN-Wissenschaftler haben sich entschieden, den Katalog der Handlungen, die als Gewalt angesehen werden können, eher breit anzulegen. Bei der Stichprobe der Online-Befragung waren Männer mit Einkommen in der unteren Mitte und niedrigeren Bildungsabschlüssen im Vergleich zu anderen Studien leicht unterrepräsentiert. Die Studienteilnehmer haben sich selbst als gewaltbetroffen eingeordnet, ein Abgleich mit anderen Perspektiven, etwa mit den Partnerinnen, fand nicht statt.
Nina Lenhardt
Alle Texte der Recherche im Überblick:
➡ #WRstory: Wenn Männer Opfer von Partnerschaftsgewalt werden
➡ Ruhe im Karton: Wie in Oldenburg Deutschlands erste Männerschutzwohnung entstand
➡ Nachgefragt: Warum viele Bundesländer keine Zufluchtsorte für Männer anbieten
➡ Ministerin Lisa Paus: „Ich führe das Gesellschaftsministerium – und das ist auch für Männer da“
➡ BFKM-Chef Frank Scheinert: „Es ist unser Job, immer wieder die Hand zu heben“
➡ Nachgefragt: Wie die Polizei auf Beziehungsgewalt gegen Männer blickt
➡ Christiane Feichtmeier (GdP): „Wir als Polizei müssten mehr sensibilisiert werden“
➡ Traditionelle Männerbilder: Die Schwäche der Superhelden
➡ KFN-Studie: Fakten und Zahlen zur Untersuchung von Partnerschaftsgewalt gegen Männer
➡ KFN-Studienleiter Schemmel: „Das fehlende Selbstverständnis als Opfer spielt eine zentrale Rolle“