Wenn bei Familie Erler früher der Gong durchs Haus tönte, kamen sie alle angelaufen: Ehemann, drei Söhne und eine Tochter, hungrig aufs Abendessen und auf Gespräche. Am großen Tisch wurde lebhaft geredet, es gab viel Pro und Contra und wurde auch mal turbulent. Inge Erler liebte es, mittendrin zu sein. Die Verschiedenheit ihrer Kinder zu erleben und die reifenden Persönlichkeiten zu begleiten, „sie auch mal aushalten und ihnen trotzen zu müssen“, sagt sie. Wenn sie erzählt und dabei strahlt, spürt man, wie voll ihr Herz ist bei der Erinnerung.

„Chaos-Königin“ sei sie damals oft genannt worden. „Und manchen Freunden war der Trubel auch zu viel.“ Inge Erler wurde es selten zu viel. Oft saß sie abends noch auf Bettkanten, sprach mit jedem Kind, bis sie selbst todmüde war. Leichte Jahre waren das nicht mit dieser Bande, „aber prägende“, sagt sie. „Deshalb kann ich das, was ich heute tue. Menschen intensiv zuhören, Lotsin sein.“
Inge Erler hilft und tröstet
Seit mehr als 25 Jahren hilft Erler Menschen in Not. Von 1996 bis 2015 hauptberuflich als Sozialarbeiterin bei der Diakonie in Meißen. Seit Ende 2015 als Gründerin und Leiterin der
Außenstelle Meißen des WEISSEN RINGS in Sachsen. 72 Jahre alt ist sie mittlerweile, und eigentlich hatte sie sich den Ruhestand schon längst verdient. Als Sozialarbeiterin hatte sie zwei Mal miterlebt, wie die Elbe über die Ufer trat und viele Menschen um ihr Zuhause, um Hab und Gut brachte. Sie hatte geholfen und getröstet. Sie hatte Gewaltopfer beraten, die schwer traumatisiert waren und Angst hatten, ihre Wohnung zu verlassen. Sie hatte sich um Frauen gekümmert, die sexuellen Missbrauch erfahren hatten. Erler hatte zugehört, nachgedacht, Hilfe vermittelt. Sie war gut vernetzt mit Kriseninterventionsteams, psychosozialen Diensten, Anwältinnen und Anwälten und anderen Engagierten. Als sie schließlich in Rente ging, hielt sie es genau einen Monat lang aus, nichts zu tun. „Ich wusste ja, was hier in der Gegend los ist. Und was fehlte.“ Was fehlte, war eine Anlaufstelle für Opfer von Kriminalität. Den WEISSEN RING kannte sie bereits, ihr Vorschlag zum Aufbau einer Außenstelle wurde in Mainz gleich begrüßt.
Wer heute Erlers Hilfe braucht, ruft sie an oder kann sie an zwei Tagen pro Monat in einem Büro in der Meißener Beratungsstelle der Verbraucherzentrale aufsuchen. Anfangs, als es das Büro noch nicht gab, saß sie mit Hilfesuchenden in Cafés. „Das war keine gute Umgebung“, sagt sie, „denn oft fließen ja Tränen in diesen Gesprächen.“ Hat sie auch mal mitgeweint? „Ja“, sagt Erler, „selbst wenn das nicht ganz professionell ist. Aber manche Geschichten sind einfach zu hart.“ Ein Schutzraum sei enorm wichtig, viele Opfer verspürten große Scham und Schuldgefühle. „Sie denken, sie sind selbst schuld an dem, was ihnen angetan wurde – weil sie sind, wie sie sind.“ Erler schüttelt den Kopf und fährt sich durch das dichte, silbergraue Haar. „Kein Opfer ist selbst schuld!“
Neustart mit Anfang 40
Ihre erste Berufswahl war die soziale Arbeit nicht. Sie studierte Werkstoffwissenschaften und arbeitete als Ingenieurin im nahegelegenen Stahl- und Walzwerk Riesa, einem Volkseigenen Betrieb (VEB), wo sie in der Forschungsabteilung an der Rezeptur für die Kufen von Profi-Rodelschlitten tüftelte. „Die besonders hart zu machen, dafür habe ich gebrannt“, sagt Erler. Dass die Rodler aus der DDR bei Wettkämpfen so gut abschnitten, macht sie heute noch stolz. Nach der Wende aber wurde der Betrieb geschlossen. Erler musste neu beginnen, studierte mit Anfang 40 noch einmal, Sozialarbeit. Das Handfeste, Pragmatische hat sie mitgenommen in ihr neues Aufgabenfeld.
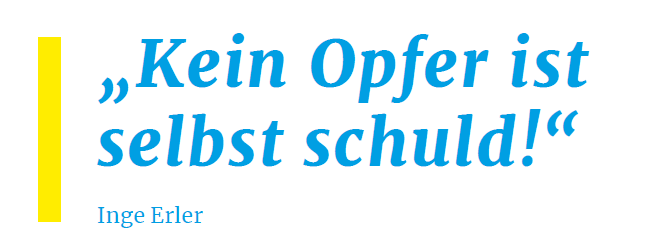
Ihr anderes Lieblingsmaterial, neben dem Stahl, ist Erde. Der Boden in dem sächsischen Dörfchen Staucha, in dem sie heute ihr Gemüse zieht, ist derselbe, auf dem sie ihre ersten Schritte ging. Erler war eine Hausgeburt, als drittes Kind 1951 zur Welt gekommen. Das Haus war im Krieg zerschossen worden, ihre Mutter und Tante hatten es wieder aufgebaut. Der Vater kam erst 1950 zurück, nachdem ihn die Sowjetische Militäradministration fünf Jahre im Speziallager Buchenwald interniert hatte. Versorgungsoffizier in der Wehrmacht sei er gewesen, sagt Erler, da gebe es nichts zu beschönigen. Zum Elternhaus gehörte etwas Ackerland und auch ein Pferd, das die Rote Armee beim Einmarsch zurückgelassen hatte, mit blutigen Hufen. Erlers Familie pflegte es gesund und Jahre später spannten sie und ihr Vater das Tier vor den Pflug und zogen Furchen in den Boden. „Wie gut das roch!“ Sie schließt die Augen. „Erdung“, das Wort benutzt sie gerne, wenn sie erzählt, wie sie an ihrem Dörfchen Staucha hängt, in dem sie ihr ganzes Leben verbracht hat. Wie sie in ihrem Zuhause auftankt, das nur wenige Schritte von ihrem Elternhaus entfernt liegt. Ganz besonders viel Erdung verspürt sie im Garten, beim Säen und Ernten – und wenn die Kinder zu Besuch kommen.
Die Schattenseiten von Social Media
Die wohnen alle in der Region und bringen heute ihre eigenen Kinder mit. Zehn Enkel gibt es mittlerweile. Höhepunkt des Großfamilienlebens sind seit 2008 die jährlichen Ausflüge an den Hölzernen See bei Königs-Wusterhausen in Brandenburg, für den sich alle Urlaub nehmen. Dann mieten sie ein Haus in einem „KiEZ“, einem Kinder- und Erholungszentrum mit einfacher Einrichtung und Verpflegung, gehen baden, spielen Ball oder Wikingerschach und machen abends ihr eigenes Kulturprogramm mit Musik und Aufführungen. Und natürlich sitzen wieder alle an einem großen Tisch und Erler fühlt sich fast wieder wie früher, als Chaos-Königin. „Das ist mein Reichtum“, sagt Erler. Sie weiß, wie glücklich sie sich schätzen darf mit dieser Familie, und von der Kraft, die sie daraus schöpft, gibt sie gerne etwas ab.
Nachfrage ist da. Erler schaut mit Sorge auf die Jugend, die oft naiv mit Social Media umgeht, freizügige Selfies versendet, als Täter oder Opfer verstrickt ist in Cybermobbing und die Häme von Chatgruppen. Das Bedürfnis nach schnellen Likes sei groß, sagt sie, wirkliches Interesse aneinander und Geborgenheit dagegen seltener zu finden. Aufklärung ist deshalb ihr großes Anliegen.
2025 will sie aufhören mit der Arbeit im Verein. Bis dahin aber will Erler die Angebote in Meißen noch entscheidend verändern: den heute kleinen Anteil der Prävention auf 50 Prozent steigern. Zum Beispiel, indem sie mit ihrem Team Geld für Filmvorführungen sammelt, die Kinder und Jugendliche sensibilisieren sollen. „Ben X“ steht als Erstes auf dem Programm, ein Spielfilm über Cybermobbing, Gaming und Vereinsamung. Mit solchen Formaten, weiß Erler, erreicht sie die Teenager besser als bei belehrenden Vorträgen in Klassenzimmern.
Mit beiden Füßen auf dem Boden, im Kopf und im Herzen vernetzt über Generationen und mit der gesamten Region: Inge Erler weiß genau, was in der Welt vorgeht, im Guten wie im Schlechten – selbst ohne ihr Dorf je verlassen zu haben.
Hiltrud Bontrup





