Adelina Michalk hat wenig Zeit, eine gute Stunde vielleicht. Dafür ist sie bestens vorbereitet: So hat sie sich überlegt, die Fotos vorm Gespräch zu machen, damit man danach bis zur letzten Minute reden kann. Sie kommt einem gleich entgegen, durchs Treppenhaus des altehrwürdigen Altonaer Rathauses, das Smartphone in der Hand, für alle Fälle. Michalk, den Eindruck gewinnt man bald, ist strukturiert und planvoll. In ihrem Büro stehen Tee und Kekse bereit, ihre Tasche für den Anschlusstermin hat sie schon gepackt. Etwas überraschend zwischen all der Effizienz: die sphärischen Klänge, die aus dem Computerlautsprecher herüberschwingen. „Das ist mein Geheimnis bei der Arbeit“, sagt sie, „Entspannungsmusik. Die höre ich den ganzen Tag lang, und das wirkt tatsächlich.“ Jetzt schaltet sie sie ab und setzt sich kerzengerade hin: kann losgehen.
Michalk, 40 Jahre, ist seit 2022 stellvertretende Vorsitzende im Landesverband Hamburg des WEISSEN RINGS. Das ist eins ihrer Ehrenämter. Beruflich arbeitet sie im Bezirksamt Hamburg-Altona als Fachkraft für Integration und Diversität. Mit Opfern beschäftigt sie sich in beiden Rollen — oder vielmehr damit zu verhindern, dass Menschen Opfer werden, von Diskriminierung, hassmotivierten Verbrechen, Gewalt. Anders als viele Ehrenamtliche des Vereins, die persönlich ansprechbar sind für Menschen in Not, agiert Michalk auf der Metaebene, im Aufbau von Kontakten, Netzwerken und Öffentlichkeitsarbeit. „Das liegt mir mehr“, sagt sie. Fallarbeit, auch mit Opfern, hat sie beruflich fünf Jahre lang gemacht, im Rahmen der Gewaltprävention in der Jugendhilfe. „Da war natürlich jeder Fall und jeder Mensch anders, aber das Prozedere war immer das gleiche“, sagt sie. „Es passte zwar gut zu meinem Studium, aber irgendwann wollte ich was Neues machen.“
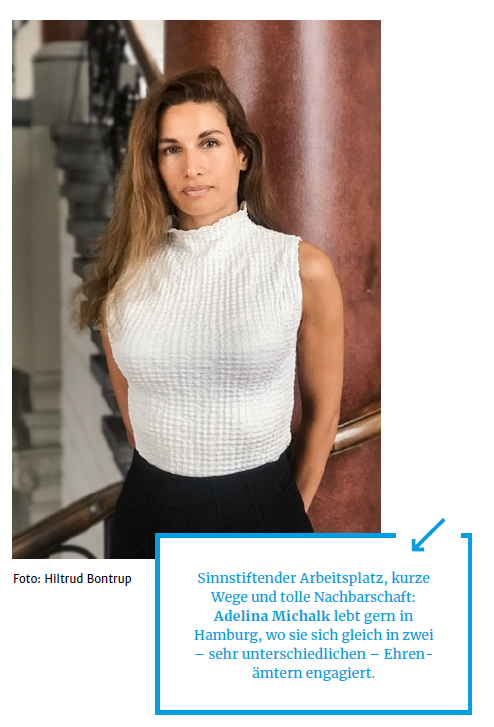
Studiert hat sie zunächst Sozialpädagogik. Sie merkte bald, dass das Fach Kriminologie sie dabei am meisten interessierte. Michalk wählte es als Masterstudiengang und konzentrierte sich auf Viktimologie, die Lehre von den Opfern. Ihre Abschlussarbeit schrieb sie über Nachahmungseffekte bei Schulmassakern. Sie untersuchte, warum sich nach School Shootings wie in der US-Kleinstadt Columbine die Nachahmungstaten häuften, auch in Deutschland, in Winnenden zum Beispiel. Ihre Antwort: Den Tätern wurde viel zu viel Aufmerksamkeit gewidmet, gerade in den Medien. „Man muss Tätern diese Aufmerksamkeit entziehen, sonst generiert man Trittbrettfahrer“, sagt Michalk. „Es ist total verrückt! Da gab es ganze Subkulturen, die neue Massaker als Hommage an ihre Vorbilder planen. Denen darf man kein Material liefern für Glorifizierungen.“ Michalk redet stets schnell, druckreif und sachlich, in diesem Moment aber merkt man, wie das Thema sie noch heute bewegt. Die Berichterstattung, sagt sie, müsse sich um die Opfer drehen und viel sensibler werden.
Da sie sich im Studium auf Kriminalitätsopfer fokussierte, absolvierte Michalk Praktika in der Zeugenbetreuung bei Gericht — so entstand Kontakt zum WEISSEN RING. Mit 26 trat sie in die Gruppe der „Jungen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“ des Landesverbands ein. Es waren die Ehrenämter beim WEISSEN RING, als Junge Mitarbeiterin und dann als Jugendbeauftragte, die Michalk zeigten, wie sie beruflich wirken wollte: thematisch, steuernd, netzwerkend. Und so wechselte sie auch den Job, als sich die Gelegenheit bot: weg von der Fallarbeit, hin zur Koordinierung.
Im Bezirksamt hat sie bereits zum dritten Mal die Altonaer Vielfaltswoche mit auf die Beine gestellt: Verschiedenste Gruppen werden eingeladen, Veranstaltungen anzubieten, um sichtbarer zu werden. Ziel ist es, das Zusammenleben in diesem enorm vielfältigen Stadtteil zu verbessern, Ausgrenzung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entgegenzuwirken — zum Beispiel Rassismus, Sexismus, Homophobie, Antiziganismus, Antisemitismus, Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen oder ohne Wohnsitz.
Michalk wohnt in Altona, sie schätzt die kulturelle, ethnische Vielfalt, den Trubel. „Ich habe ja nicht nur deutsche, sondern auch malaiische Wurzeln, durch meine Mutter“, sagt sie. „Deshalb fühle ich mich hier wohler als an Orten, an denen ich womöglich als exotisch wahrgenommen werde.“ Diskriminierungserfahrungen hat sie bisher keine, anders als Mutter oder Bruder, „die sehr viel dunkler sind als ich“.
Wie ist sie aufgewachsen, mit einem deutsch-malaiischen Elternpaar? Recht behütet, sagt Michalk, in einem Reihenhaus in Hamburg-Schnelsen. Religiös sind weder Vater noch Mutter, Traditionen wie ein geschmückter Weihnachtsbaum wurden zwar gepflegt, „aber eher, weil’s cool war, und nicht mit dem christlichen Hintergrund“. Heute reist sie alle drei Jahre mit ihren Eltern in den asiatischen Vielvölkerstaat, wo auch Verwandte leben. Winkekatzen und andere Glücksbringer, die sie dort findet, hat sie auf dem Schreibtisch aufgereiht. Die Herkunft, der familiäre Hintergrund, das alles habe sie schon geprägt, sagt Michalk. „Diversity betrifft mich persönlich, diese Themen sind mir einfach sehr zugänglich.“ Um die Vielfalt und Buntheit der Welt zu genießen, hat ihr jedoch stets Hamburg ausgereicht. Es kam ihr nie in den Sinn, die Stadt zu wechseln: „Ich fühle mich hier einfach verwurzelt. Die Lebensqualität ist hoch, die Wege sind kurz in diesem Stadtstaat.“
Michalk, so scheint es, führt ein aufgeräumtes Leben. Dazu hat sie eine Mission: Gewalt zu verhindern und das menschliche Miteinander zu verbessern. Doch als die Pandemie einsetzte, bekam auch sie eine Sinnkrise. Sie gab einem Wunsch nach, der schon lange in ihr schlummerte: sich als Sterbebegleiterin im Hospiz zu engagieren. Sterben, findet sie, wird in unserer Gesellschaft geradezu tabuisiert. „Dabei ist es genauso ultimativ wie die Geburt. Klammert man es aus, lebt man nur halb. Mir fehlte dieser Pol des Daseins, weil er den Blick aufs Leben erst vollständig macht.“
Jetzt geht sie zweimal pro Monat am Sonntagnachmittag in ein kleines Hospiz und fragt alle Gäste, was sie brauchen: ein Gespräch, Vorlesen, mit dem Rollstuhl an die frische Luft? Anschließend bereitet sie Abendessen nach Wunsch, etwas Suppe zum Beispiel, einen Joghurt, ein Brot. „Manchmal denke ich, dies ist vielleicht das fünftletzte Brot, das dieser Mensch essen wird“, sagt Michalk. „Das zuzubereiten, finde ich bewegend. Und schön.“ Leicht sei es trotzdem nicht. Sie habe schon manche Lebensgeschichte gehört, hochspannende und traurige. Was hat sie daraus für sich mitgenommen? „Was ich am Ende des Lebens bedauern oder bereuen könnte“, sagt sie. „Würde ich heute sterben, hätte ich sicher einiges zu bereuen, das hat wohl jeder. Aber verpasste Chancen zu bedauern habe ich zum Glück nicht viele.“
Ein sinnstiftender Arbeitsplatz, zwei Ehrenämter und eine tolle Nachbarschaft – das klingt ja auch perfekt. Dennoch schaut Michalk kritisch auf sich selbst: „Ich lebe wie eine 27-Jährige, ohne Partnerschaft, ohne Kinder. Irgendwas muss da noch kommen, sich verändern.“ Ein so planvoller Mensch wie sie hat doch bestimmt ein Ziel, zumindest Meilensteine für die Zukunft? „Nein“, sagt sie und lacht. „So was hatte ich noch nie. In meinem Leben hat sich bisher alles immer Schritt für Schritt ergeben und war dann sehr stimmig und in der Rückschau auch stringent.“
Hiltrud Bontrup





