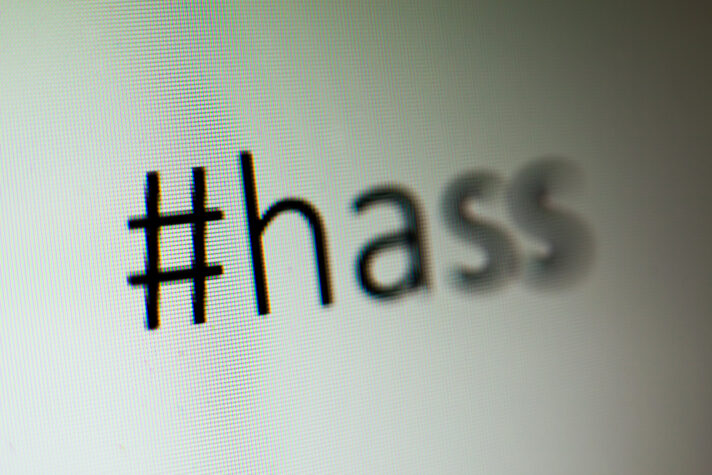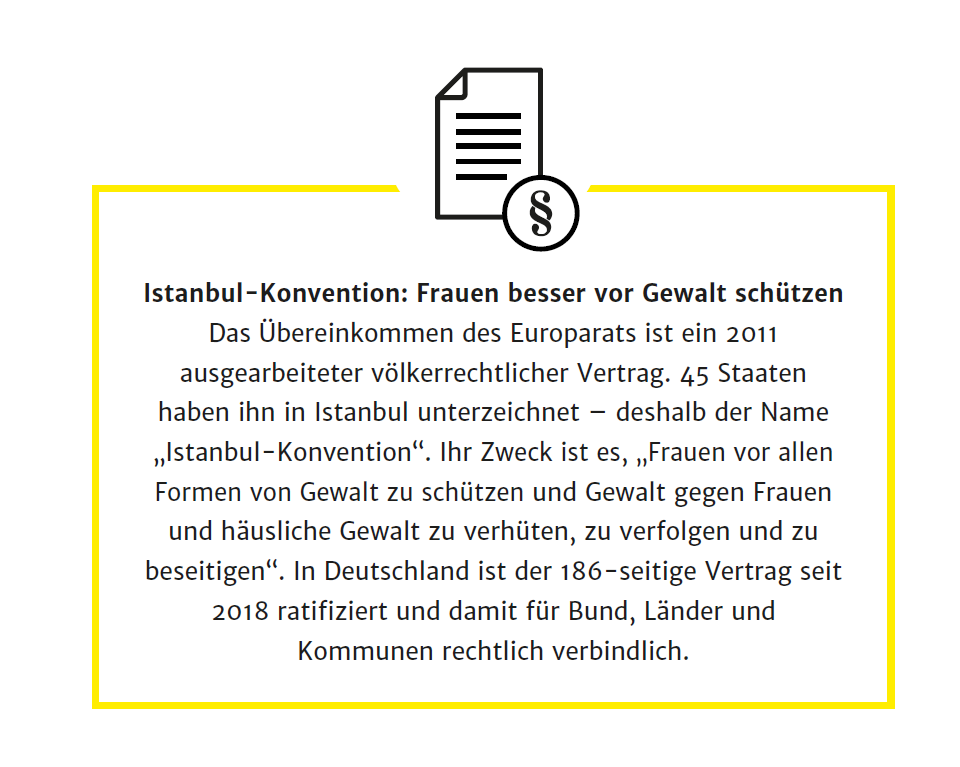
Beispiel 1: Artikel 10 – unabhängige Koordinierungsstelle
Artikel 10 der Konvention verpflichtet Deutschland, „eine oder mehrere offizielle Stellen, die für die Koordinierung, Umsetzung, Beobachtung und Bewertung der politischen und sonstigen Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung aller von diesem Übereinkommen erfassten Formen von Gewalt zuständig sind“ zu benennen oder zu errichten.
Seit Mai 2021 prüft das Deutsche Institut für Menschenrechte nach Angaben des Bundesfamilienministeriums die Voraussetzungen für die Einrichtung dieser Stellen. Ziel sei es, dass diese ab Herbst 2022 im vollen Umfang arbeiten können, so ein Ministeriumssprecher. Die Stellen werden auch dafür zuständig sein, das Sammeln und Verbreiten umfangreicher Daten zu koordinieren.
Beispiel 2: Artikel 11 – Datensammlung und Forschung
Mit der Istanbul-Konvention hat sich Deutschland dazu verpflichtet, Daten zu geschlechtsspezifischer Gewalt zu erheben und die Forschung zu fördern. So steht es in Artikel 11. Die Datengrundlage zu tödlicher Gewalt gegen Frauen ist dünn: Abgesehen von der Polizeilichen Kriminalstatistik und dem Lagebild Partnerschaftsgewalt fehlen Daten und vor allem systematische Forschung. So werden wichtige Informationen zur Vorgeschichte der Taten nicht erfasst, die für die Prävention von Tötungsdelikten zentral sind.
Dazu gehöre eine Auswertung des Umgangs mit Hochrisikofällen und den Interventionen durch Polizei und andere Akteure, schreibt das Bündnis Istanbul-Konvention (BIK), ein Zusammenschluss von Frauenrechtsorganisationen, Bundesverbänden sowie Expertinnen und Experten mit dem Arbeitsschwerpunkt Gewalt gegen Frauen, in einem Alternativbericht zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Nur wenn man wisse, wie die Maßnahmen wirken, habe man eine „wichtige Wissensgrundlage für die Verhütung weiterer Femizide“. Die zuständige Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium nannte den Alternativbericht einen wertvollen „Beitrag aus Sicht der Fachpraxis und Fachexpertise, den wir sehr ernst nehmen“.
Beispiel 3: Artikel 31 – Sorgerecht, Besuchsrecht und Sicherheit
In Artikel 31, Absatz 2 heißt es: „Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Ausübung des Besuchs- oder Sorgerechts nicht die Rechte und die Sicherheit des Opfers oder der Kinder gefährdet.“ Ein Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz in Deutschland ist aus Opfersicht besonders problematisch, wenn es gemeinsame Kinder gibt und ein Familiengericht dem Umgangsrecht des Vaters den Vorrang gibt vor dem Schutzbedürfnis der Frau. In der von der Bundesregierung finanzierten Studie „Kindeswohl und Umgangsrecht“ wurden entsprechende Regeln aus der Perspektive des Kindes untersucht. „Ein Schwerpunkt der Befragungen lag auf der Situation von Familien, in denen häusliche Gewalt eine Rolle gespielt hat“, schreibt die Bundesregierung in ihrem Bericht zum Stand der Umsetzung der Istanbul-Konvention.
In der Studie werde auch untersucht, wie das Besuchsrecht in Fällen von häuslicher Gewalt gegen Frauen ausgestaltet ist und welche Probleme dabei bestehen. Es werde erwartet, dass sich auf der Grundlage der Studie die Frage beantworten lässt, ob in Deutschland im Hinblick auf Artikel 31 Absatz 2 der Istanbul-Konvention weitere Maßnahmen geboten sind. „Was man bereits vermuten muss, ist, dass die Ergebnisse der Studie nahelegen werden, dass es derzeit Schutzlücken im Sorge- und Umgangsrecht gibt, die geschlossen werden müssen“, heißt es dazu im BIK-Alternativbericht.
Pikant: Die Studie sollte längst veröffentlicht sein, ist immer wieder vom Bundesfamilienministerium zurückgehalten worden und mittlerweile Gegenstand eines Streits vor dem Verwaltungsgericht Köln mit dem Datenschutzbeauftragten der Bundesregierung. Dabei geht es um die Frage, ob es zulässig war, sich für Befragungen von Minderjährigen von nur einem Elternteil das Einverständnis einzuholen.
Christoph Klemp