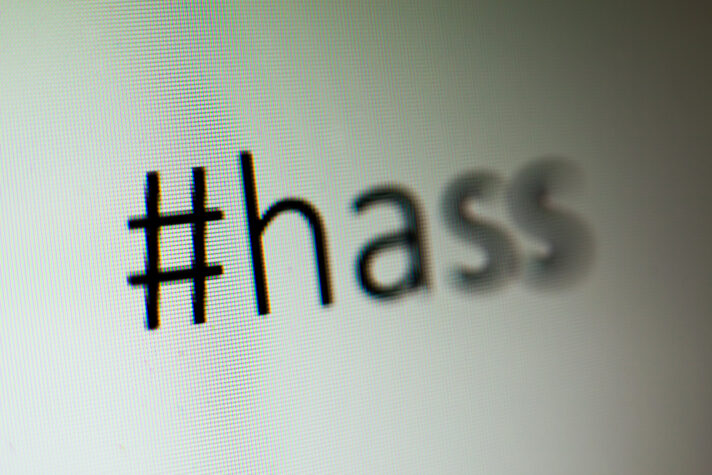Frau Staatsministerin Bär, haben Sie sich jemals gewünscht, das Internet wäre nie erfunden worden?
Nein. Erstens lebe ich grundsätzlich nicht in der Vergangenheit. Und zweitens sind in vielen Bereichen digitale Anwendungen eine absolute Lebenserleichterung. Das zeigt ja auch die Pandemie deutlich. Covid-19 und ein Lockdown wären ohne die Möglichkeiten digitaler Vernetzung vor 30 Jahren noch unaushaltbarer gewesen, als es jetzt schon der Fall ist. Diese Krise offenbart – sei es am Beispiel Home-Office oder digitales Lernen –, es geht nicht ohne digitale Anwendungen, und das hat mittlerweile auch jeder Digitalisierungsverweigerer erkannt.
Sie hätten mich auch fragen können: Hätten Sie sich gewünscht, dass das Messer nie erfunden worden wäre, nachdem jemand damit erstochen wurde? Aber zum Brotschneiden ist es eben doch eine sinnvolle Erfindung gewesen. Genauso verhält es sich auch mit dem Internet.
Das Internet wurde gerade in den frühen Jahren als Heilsbringer der Demokratie gepriesen. Jetzt zeigt es sich als Gefährder: Wir sehen Hass und Hetze, Verschwörungstheorien statt Fakten, eine gespaltene Gesellschaft. Was ist da schiefgelaufen?
Als das Internet erfunden wurde, wurde es möglicherweise zu sehr romantisiert. Ich glaube, das Internet ist per se weder gut noch böse, per se weder demokratisch noch undemokratisch, sondern es bietet Chancen und Herausforderungen für die freiheitliche Demokratie.
Das Netz ist beispielsweise eine herausragende Hilfe, was das verfügbare Wissen anbelangt: Nicht nur der, der sich einen Brockhaus leisten kann, kann sich schlaumachen. Hier ähnelt das Internet dem Buchdruck, der durch Vervielfältigung dafür gesorgt hat, dass viel mehr Menschen an Bildung, Informationen und Nachrichten haben teilnehmen können. Durch das Internet wurde dieser Effekt potenziert.
Natürlich verunsichert diese rasante digitale Entwicklung auch viele Bürgerinnen und Bürger, ähnlich übrigens wie die Themen Globalisierung oder Klimawandel. Diese zunehmende Unsicherheit, gepaart mit einer Überforderung, führt dann dazu, dass sich einige Menschen bei Frustrationen Sündenböcke suchen. Zeitgleich wurden althergebrachte Wertesysteme, ob es Religion ist oder die Mitgliedschaft im Kegelverein, aufgegeben und bieten deshalb nicht mehr die Stabilität, wie das in früheren Jahren der Fall war.
Bei diesen globalen Herausforderungen fehlt einigen dann der Wertekompass, was in Verbindung mit mangelnder digitaler Bildung dann auch zu Hass im Netz führen kann. Es wäre also zu einfach, die Schuld auf das Medium zu schieben, denn es ist vielschichtiger. Zum einen liegen die Ursachen bei den Menschen, die vor dem Rechner sitzen, zum anderen braucht es natürlich auch eine kluge Regulierung, die Hass und Hetze im Netz Einhalt und deren Verbreitung nicht befeuert.
Wir sind ein Opferschutzverein. Inzwischen schreiben uns allen Ernstes Menschen an, die fordern, wir müssten etwas gegen die überbordende Polizeigewalt tun, die der Staat dazu nutze, um sogenannte Corona-Leugner niederzuknüppeln. Corona sei ein Komplott der Eliten. Die Menschen, die uns so etwas schreiben, sind davon fest überzeugt. Ihre Quellen zu so einem Unfug finden sie im Internet. Ist das nicht für unsere Demokratie ein Riesenproblem?
Diese Menschen, die Sie jetzt beschreiben, sind die Extremfälle. Die gibt es natürlich auch. Ich habe erst vor kurzem eine Zuschrift erhalten, in der uns Politikerinnen und Politikern vorgeworfen wurde, wir würden doch gar nicht mit dem richtigen Corona-Impfstoff geimpft, wenn es einmal so weit wäre. Wir würden, wenn wir uns öffentlichkeitswirksam impfen ließen, Placebos oder irgendeine Wasserlösung nutzen. Aber Gott sei Dank glaubt das nicht die Mehrheit.
Eine große Verunsicherung über Falschmeldungen erlebe ich zum Beispiel auch fortwährend in Whats-App-Gruppen. Es werden dort Meldungen weitergeleitet, die man ohne große Mühe als Falschmeldung enttarnen könnte. Es fallen dennoch viele Bürgerinnen und Bürger darauf rein, das ist nicht nur eine Frage der Bildung. Kontakt mit Falschmeldungen kann alle treffen, teilweise findet man solche Fälle auch in der eigenen Familie, im Bekanntenkreis oder im eigenen Dorf. Das Problem ist, dass gerade Nachrichten, die im privaten Raum kursieren, oft für besonders glaubwürdig gehalten werden.
Wir als Politikerinnen und Politiker haben hier die Aufgabe, unsere Politik, die Komplexität und die Zusammenhänge unserer Maßnahmen immer wieder zu erklären und Ängste ernst zu nehmen. Es gibt natürlich einige wenige Fälle, denen ist einfach nicht zu helfen, wenn ich da etwa an die Reichsbürger denke. Solche Fälle habe ich dann allerdings nicht nur in der digitalen Welt, sondern auch „analog“ schon verloren. Aber digital haben solche Menschen dann eben aufgrund der digitalen Echokammern die Möglichkeit, ihre Verschwörungstheorien viel schneller zu teilen, und das verleiht ihnen natürlich eine gewisse Macht. Es gilt, diese Macht einzudämmen.
Wie kann das gelingen?
Für jede oder jeden Einzelnen bedeutet das: Inhalte, die strafrechtlich relevant sind, müssen auch gemeldet werden – also nicht nur blockieren, nicht nur löschen, sondern tatsächlich zur Anzeige bringen. Ich weiß, dass die Hemmschwelle groß ist, ich bekomme ja auch selber viel Mist zugeschickt den ganzen Tag. Und sich jedes Mal dann aufzuraffen, die Hassnachrichten anzuschauen, um sich dann zu fragen: „Will ich mich damit jetzt das nächste halbe Jahr beschäftigen?“, ist natürlich müßig. Aber ich kann immer nur wieder auffordern, die Inhalte zu melden und zur Anzeige zu bringen. Denn wenn es den Täterinnen und Tätern an den Geldbeutel geht, ist das eine Möglichkeit, den einen oder anderen wieder zur Vernunft zu bringen.
Wir als Bundesregierung stehen vor der Herausforderung, einen zeitgemäßen Rechtsrahmen zu schaffen. Seit 2017 gibt es in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das hier entscheidende Vorstöße macht und auch fortentwickelt wird.

Foto: Christoph Soeder
Auch auf europäischer Ebene arbeiten wir mit dem Vorschlag für einen „Digital Services Act“, der im Dezember 2020 von der Europäischen Kommission vorgelegt wurde, daran, hier klare Regeln aufzustellen: Betreiber von sozialen Netzwerken müssen konsequent zum Beispiel gegen Hass, Hetze, Falschnachrichten und terroristische Inhalte vorgehen. Sie treffen umfassende Transparenz- und Sorgfaltspflichten, deren Erfüllung sie auch gegenüber Behörden nachzuweisen haben. Aber wir sollten hier auch globaler denken: Ich hoffe bei der Plattformregulierung auch auf ein neues transatlantisches Bündnis zusammen mit der neuen US-Regierung.
Sie sagten, Sie bekommen „viel Mist“ zugeschickt. Was bekommen Sie da? Und haben Sie das Gefühl, das hat zugenommen?
Ich bin ja seit 18 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestags. Als ich im Bundestag anfing, gab es die Sozialen Netzwerke in der Form noch nicht. Da hat man Drohbriefe zugeschickt bekommen, meist anonymisiert. Früher habe ich die Drohungen unterschiedlich ernst genommen, je nachdem, über welches Medium die Bedrohung transportiert wurde. Ich persönlich fand zum Beispiel Drohbriefe meistens viel erschreckender als eine E-Mail. Denn der Verfasser oder die Verfasserin eines Drohbriefes hat sich in der Regel Mühe gemacht, den Drohbrief zu verfassen – schreiben, noch einmal eine Nacht darüber schlafen, zum Briefkasten fahren, den Brief einwerfen. Einen Drohbrief zu verfassen, ist keine Affekthandlung, sondern wohlüberlegt.
Als Adressatin weiß man dann genauer, woran man ist: Der Absender oder die Absenderin meint es sehr ernst, er oder sie hat so viel Hass verspürt, um doch einigen Aufwand auf sich zu nehmen und den Brief tatsächlich abzuschicken. Das fand ich wesentlich beunruhigender als eine Droh-E-Mail, bei der man als Leser oder als Leserin merkt, da sind 100 Rechtschreibfehler drin, keine Zeichensetzung, die wurde einfach mal rausgeschickt und nicht noch mal durchgelesen. Ähnlich ist es mit dem Aufkommen von Nachrichten in den Sozialen Medien, wo dann irgendwelche Kommentare überhitzt und voreilig versendet werden.
Ich glaube aber schon, dass insgesamt die Gewalt und die Gewaltbereitschaft gegenüber Politikern und Politikerinnen zugenommen haben. Das erlebe ich auch im Kollegen- und Kolleginnenkreis: Erst gestern Abend habe ich wieder gehört, dass ein Wahlkreisbüro eines Kollegen zerstört wurde.
Bei mir persönlich kommt dazu, dass ich sehr stark im Internet vertreten bin. Dadurch hat jeder oder jede irgendeine Meinung zu mir. Und einige glauben, da es um eine Person des öffentlichen Lebens geht, hätten sie einen Freifahrtschein für schlechte Manieren sowie Hass und Hetze.
Fühlen Sie sich bedrohter als früher?
Ich gehe relativ angstfrei durchs Leben. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich über jede fiese Zuschrift freue. So masochistisch ist, glaube ich, niemand veranlagt. Und ich versuche auch, negative Energie nicht so an mich heranzulassen. Natürlich kommt es vor, dass ich mich einmal ein paar Minuten darüber aufrege. Aber wer in die Politik geht, der weiß, dass man diesen Beruf nicht ausübt, um nur gelobt oder gemocht zu werden.
Wenn jemand strafrechtliche Grenzen überschreitet oder Sie bedroht, zeigen Sie ihn dann konsequent an?
Ja, meistens schon. Ich rate auch immer jedem dazu, es zu tun. Und ich freue mich über Kolleginnen und Kollegen, die dann beispielsweise auf Twitter die Beispiele teilen und sagen: So, angezeigt, das ist passiert, da kam diese Abmahnung raus, da kam jene Geldstrafe raus. Weil das auch immer wieder eine Aufforderung für andere ist, das auch zu tun und ein Zeichen zu setzen.
Bei Leserbriefen in der Zeitung wird der Absender kontrolliert, Beleidigungen oder strafrechtliche Inhalte werden nicht gedruckt, weil der Verlag dafür haftet. In den sozialen Medien gibt es das nicht, obwohl Facebook sozusagen der größte Verlag der Welt ist. Warum gelten da andere Regeln?
Ich teile Ihre Einschätzung nicht, dass bei den Leserbriefen so wahnsinnig darauf geachtet wird. Ich hatte neulich erst wieder einen Leserbrief gegen mich in einer lokalen Zeitung, der so sexistisch war, dass ich mich gewundert habe, dass die Zeitung das abgedruckt hat. Das ist aber nur meine subjektive Sichtweise, darüber kann man sich streiten. Soziale Netzwerke haben eine sehr große Macht, da der digitale Raum für die meisten unverzichtbar geworden ist, um sich auszutauschen.
Und die Pandemie hat die Verschiebung der Marktverhältnisse hin zum Digitalen eklatant beschleunigt. Wir können nicht mehr ignorieren, welche Macht die digitalen Plattformen bei der Verbreitung von Inhalten haben. Deshalb muss der Rechtsrahmen immer an die heutige Zeit angepasst werden. Die Erstürmung des Capitols oder die Corona-Pandemie haben uns diesen Handlungsbedarf noch einmal sehr offengelegt.
„Nationale Regelungen alleine reichen einfach nicht. Der digitale Raum macht nicht an nationalen Grenzen halt.“
– Dorothee Bär
Wir haben als Bundesregierung bereits davor mit der Einführung des Netzwerkdurchsetzungs-gesetzes und den Änderungsgesetzen, deren Einführung kurz bevorsteht, wichtige Regelungen zur Regulierung geschaffen. Wir haben mit dem NetzDG ein Gesetz beschlossen, dass die Netzwerke noch einmal wesentlich stärker in die Pflicht nimmt. Offensichtlich rechtswidrige Inhalte müssen von den Anbietern innerhalb von 24 Stunden nach Eingang einer Beschwerde gelöscht werden. Bei Verstößen gibt es dann Bußgelder.
Aber: Nationale Regelungen alleine reichen einfach nicht. Der digitale Raum macht nicht an nationalen Grenzen halt. Wir brauchen internationale Lösungen und ein Einvernehmen darüber: Was ist eigentlich ein rechtswidriger Inhalt? Bis Oktober letzten Jahres war es kein Straftatbestand in den USA, den Holocaust auf Facebook zu leugnen. In Deutschland ist es auf der gleichen Plattform ein Straftatbestand. Wir müssen hier also größer und mindestens europäisch denken. Deswegen begrüße ich den Vorschlag der EU-Kommission zur Regulierung von Plattformen im „Digital Services Act“. Große Plattformen müssen Mechanismen schaffen, um den Risiken der Verbreitung von terroristischen oder anderen strafbaren Inhalten zu begegnen, effektive Meldewege und auch mehr Transparenz zu schaffen, zum Beispiel über die kommerzielle Werbung, die Menschen auf den Plattformen begegnet.

Sie sprachen gerade das Netzwerkdurchsetzungsgesetz an. Ist es ein Geburtsfehler des Gesetzes, dass man die juristische Verantwortung outsourct an die Plattformbetreiber?
Das ist einer der Punkte, die man zu Recht kritisieren kann. Aber wir müssen auch Lösungen haben, die in der Praxis praktikabel sind. Momentan ist es bei der Masse der Inhalte schwer anders lösbar, als dass auch die Plattformen zur Bewältigung der Herausforderung beitragen. Aber natürlich spielt auch der Rechtsweg eine wichtige Rolle.
Zurück einmal zu den Ereignissen in den USA: Erst geschahen die Angriffe auf das Capitol, kurz darauf sperrten Plattformen wie zum Beispiel Twitter den Account des US-Präsidenten. Finden Sie es richtig, dass Plattformen die Macht haben, den Account des mächtigsten Mannes der westlichen Welt zu sperren?
Ich sage ganz offen – jeder ist ja nur ein Mensch – ich war in der ersten Sekunde über Trumps Sperrung sehr erleichtert. Aber natürlich ist es nicht in Ordnung.
Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht von elementarer Bedeutung. In dieses Grundrecht kann eingegriffen werden, aber entlang der Gesetze und innerhalb des Rahmens, den der Gesetzgeber definiert, und nicht nach dem Beschluss der Unternehmensführung von Social-Media-Plattformen.
Wir können die Macht der Plattformen nicht mehr ignorieren, sie sind mehr als ein Gastwirt, der mal von seinem Hausrecht Gebrauch macht. Plattformen stellen den Raum für Öffentlichkeit und demokratischen Diskurs. Das sind Megakonzerne, die momentan entscheiden, wer seine Meinung äußern darf und wer nicht.
Ist es also richtig, dass ein Konzern entscheiden kann, welcher Politiker was sagen darf? Das denke ich nicht. Wir reden hier ja nicht über die Kennzeichnung von einigen Tweets, sondern über den dauerhaften Ausschluss, das ist eine ganz andere Nummer, weil hier eine komplette Möglichkeit der Kommunikation entzogen wird. Das sollte man nicht so feiern, wie es teilweise gemacht wird. Ein hilfreiches Gedankenexperiment ist hier, sich zu vergegenwärtigen, wie die Situation mit anderen Vorzeichen ausgesehen hätte. Dass nun gefühlt für viele der Richtige ausgeschlossen wurde, wäre als Genugtuung brandgefährlich.
Wer will das denn entscheiden? Die Justiz?
Die Legislative setzt den gesetzgeberischen Rahmen, im „Digital Services Act“ stärken wir auch noch einmal die Rolle Aufsichtsbehörden, und die Justiz nimmt sich der rechtlichen Streitfälle an. Das ist der gängige Dreiklang, der auch hier gilt. Man muss sich ja auch einmal vergegenwärtigen, welch gravierende Folgen ein Rauswurf mit sich bringt. Die Betroffenen können sich weiter radikalisieren, wenn die Ausweichplattformen weniger stark regulieren und die Gegenrede durch Andersdenkende wegfällt. Wenn sich Menschen in Nischen begeben, die dann für die Strafverfolgung wesentlich schwerer zu beobachten und zu verstehen sind, treffen sich auf diesen Plattformen ausschließlich Menschen, um sich in ihrem Weltbild zu verstärken. Dieser gefährlichen Dynamik dann Einhalt zu gebieten, wird wesentlich schwerer. Sprich: Das ist ein so sensibles Feld, natürlich muss der Gesetzgeber den Rahmen vorgeben und nicht die Plattformen selbst.
„Als Mutter von drei schulpflichtigen Kindern freut es mich nicht, Arbeitsblätter zu finden, die ich schon vor 30 Jahren bearbeitet habe. Die Welt hat sich doch 30 Jahre weiterentwickelt.“
– Dorothee Bär
Sind die sozialen Medien die Vierte Gewalt im Staat geworden?
Jedenfalls haben sie neben den klassischen Medien eine ganz enorme Wucht entwickelt. Als Bertha Benz ihre erste Autofahrt unternommen hat, gab es keine Straßenverkehrsordnung. Sie ist losgefahren, hatte keine Autobahnen und musste an keiner Ampel halten, weil es keine gab. Heute ist das anders. So ist es auch bei den sozialen Netzwerken. Wir brauchen Regeln und können das eben nicht dem Markt überlassen. Wir könnten das gedanklich ja noch weiterspinnen und sagen, was da geschehen ist, geschah in den USA, und das ist unser Bündnispartner und eine Demokratie. Aber nehmen wir mal an, die Verhältnisse ändern sich und Plattformen aus anderen Regionen der Welt, die keine Demokratien sind, gewinnen mit sozialen Netzwerken an Boden. Dann wird noch deutlicher, dass wir es in keinem Fall der Plattform selbst überlassen können, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit verlaufen.
Sie sagten, Sie bekommen Dinge auf WhatsApp zugeschickt, bei denen man mit drei Klicks herausfinden könnte, dass es ein Fake ist. Müsste es nicht Aufgabe der Schule sein, Menschen Medienkompetenz zu lehren? Die Schulen fragen zwar oft zu Recht, was sie eigentlich noch alles leisten sollen. Aber muss Quellenprüfung und Recherche nicht Hauptfach sein heute?
Ich habe selber viele Lehrerinnen und Lehrer in der Familie und verstehe die Frage, was man eigentlich noch alles machen soll. Aber es gibt halt Bereiche, die schaffen die Elternhäuser nicht. Und hier geht es nicht um ein Add-on, hier geht es um die Entrümpelung von Lehrplänen. Als Mutter von drei schulpflichtigen Kindern freut es mich nicht, Arbeitsblätter zu finden, die ich schon vor 30 Jahren bearbeitet habe. Die Welt hat sich doch 30 Jahre weiterentwickelt!
Um auf Ihre Frage zu antworten: Ja, das Thema muss in die Schulen, definitiv. Wir diskutieren gerade auch über einen Digitalpakt Kita, denn die Affinität und Sensibilität für digitale Themen können wir schon früh anbahnen. Das ist auch Grundlage für die komplexere Auseinandersetzung mit diesen Themen, wenn die Kinder dann älter sind. Auch Kinder müssen wissen, was ein Algorithmus ist. Oder künstliche Intelligenz. Was sind Fake News? Sie beide haben ja bei Zeitungen gearbeitet. Das habe ich in der Schul- und Studienzeit auch getan. Erschreckend ist, wenn ich mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen sprechen: Die können heute keine Aprilscherze mehr in ihren Zeitungen abdrucken! Wenn sie das tun, haben sie anschließend so viele Anrufe und Leserbriefe, das sei der Wahnsinn. Weil niemand mehr darauf kommt, dass am 1. April ein Aprilscherz in der Zeitung stehen könnte. Denn auch das Thema Quellenkompetenz scheint allgemein etwas abhandengekommen zu sein.
Medienkompetenz muss in die Schulen – aber nicht nur. Wenn wir davon ausgehen, dass über 60 Prozent aller Grundschülerinnen und Grundschüler später in Berufen arbeiten werden, die es heute noch gar nicht gibt, dann muss ich sie auf eine andere Welt vorbereiten. Schule muss komplett neu und disruptiv gedacht werden.
Als Väter führen wir Diskussionen, dass die Kinder ein Gerät oder einen Account in sozialen Medien haben möchten. Wie gehen Sie damit um als Mutter?
Ich habe mir tatsächlich immer vorgenommen, dass unsere Kinder mobile Endgeräte erst dann bekommen, wenn sie auf eine weiterführende Schule gehen. Durch Corona und Homeschooling haben sich die Vorzeichen natürlich jetzt geändert. Für den digitalen Lernunterricht während Corona haben die zwei Kleinen, die in der dritten und vierten Klasse sind, gebrauchte Tablets bekommen. Es finden sogar der Schlagzeugunterricht und das Leichtathletiktraining digital statt. Ansonsten bin ich da extrem streng. Meine Kinder dürfen sich nichts aus dem Internet herunterladen, was ich nicht gesehen habe. So haben wir es bei der Ältesten auch gemacht. Sie hat einen geschlossenen Account, darf nie ihr Gesicht zeigen, und jeder, der sie in sein Netzwerk hinzufügen will, muss von mir freigegeben werden. Das ist für meine Kinder natürlich ziemlich „uncool“, aber das nehme ich sehr ernst.
Tobias Großekemper und Karsten Krogmann
Dorothee Bär, geboren 1978 in Bamberg, sitzt seit 2002 für die CSU im Deutschen Bundestag. Seit 2018 ist sie Staatsministerin im Bundeskanzleramt, Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung.