Herr Dr. Nölleke, warum ist Online-Hass im Sport aus Ihrer Sicht so ein großes Thema?
Im Sport ist das Problem ausgeprägter als in anderen Bereichen: Prominente Sportlerinnen und Sportler sind bereits lange mit Hass und Hetze konfrontiert – im Fußball zum Beispiel. Im Stadion scheint es fast schon ein geduldeter Teil der „Fankultur“ zu sein, Leute zu beleidigen und zu beschimpfen. Hinzu kommt jetzt, dass die Logik von sozialen Netzwerken ein idealer Nährboden für Pöbeleien und Drohungen ist.
Was ist der Anlass für den Hass, und welche Gruppen äußern diesen?
Das sind ganz unterschiedliche Gruppen und Anlässe. Beim Skateboarding kann es passieren, dass Skaterinnen und Skater aus den eigenen Reihen angegriffen und beleidigt werden, weil sie durch ihre Teilnahme an Olympischen Spielen angeblich die Glaubwürdigkeit der Szene aufs Spiel setzen. Viele Reitsportlerinnen und Reitsportler sehen sich massiven Drohungen von Tierschutzaktivisten ausgesetzt. Manchmal sind es kleine Anlässe, an denen sich Online-Hass entzündet. Diese Wirkmechanismen besser zu verstehen ist ein Ziel unseres Forschungsprojekts. Es sind nicht immer die polarisierte rechtspopulistische Gesellschaft oder aus Russland gesteuerte Computer-Bots, die Leute online attackieren.
Bleiben wir kurz bei der polarisierten Gesellschaft. Haben sich da aus Ihrer Sicht die Grenzen des Sagbaren verschoben?
Es ist sehr offensichtlich, dass da Grenzen verschoben worden sind in Bezug auf Hass und Hetze – auch weil es so vorgelebt wird von populistischen Politikerinnen und Politikern. Weil immer seltener zwischen Fakten und Meinungen getrennt wird. Weil es schnell heißt, das ist „Cancel Culture“ oder „hier wird meine Redefreiheit eingeschränkt“, sobald etwas gegen Hassrede gesagt wird.
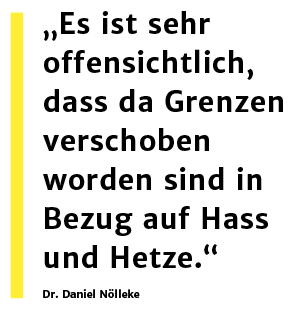
Die scheinbare Anonymität im Netz wird oft als Grund angeführt, warum Hass und Hetze online so stark verbreitet werden.
Es gibt dazu sehr viel Forschung, die besagt, dass es so einfach nicht ist. Die Leute machen das sehr oft unter ihren Klarnamen. Ich glaube trotzdem, dass Anonymität eine Rolle spielt, im Sinne einer gefühlten Anonymität, durch eine Gruppendynamik, in der Einzelne gar nicht so eine große Rolle spielen. Ich kommentiere also nicht als Daniel Nölleke, sondern als Teil einer Gruppe. Das kennt man aus Fußballstadien, zum Beispiel, wenn Spieler oder Schiedsrichter kollektiv ausgepfiffen oder übelst beschimpft werden. Diese Stadionatmosphäre macht was mit einem. Zum anderen steht Sport per se für Emotionen, für Jubel und Enttäuschung. Der Sport in Stadionatmosphäre ist prädestiniert für polarisierende Äußerungen. Es ist sehr plausibel, dass es ähnliche Mechanismen in Kommentarspalten von Social-Media- Accounts und Online-Foren gibt, in denen man sich plötzlich als Teil einer Gruppe von Gleichgesinnten fühlen kann.
Was sagt die Forschung zu den Auswirkungen auf die Sportlerinnen und Sportler?
Auch da ist die Antwort leider unbefriedigend. Während Vereine und Verbände den Online-Hass mittlerweile als gravierendes Problem erkannt haben, fehlt es vonseiten der Forschung bislang weitgehend an systematischem Wissen zu Hassrede im Sport.
Sie sind Anfang Juli mit Ihrem Forschungsprojekt an den Start gegangen, passend zu Olympia 2024 in Paris. Was haben Sie dort wahrgenommen?
Wir werten die Daten gerade aus. Was ich schon sagen kann: Wir haben leider auch zu diesem Event einiges an Hass gefunden im Netz. Natürlich die unsägliche Diskussion um die „männliche“ Boxerin Imane Khelif aus Algerien. Das war schon ein heftiger Fall. Oder die australische Breakerin Rachael Gunn alias „Raygun“, die null Punkte bekommen hat und in der Folge im Internet sehr viel Hass und Häme erfahren musste. Aber uns haben vor allem Zwischen-den-Zeilen-Geschichten interessiert. Zum Beispiel, wenn Spielerinnen und Spielern eine deutsche Identität abgesprochen wurde mit dem Clowns-Emoji hinter der Frage „Deutsch?“. Oder wenn jemand zu einzelnen Athletinnen und Athleten postet: „Paralympics?“. Dahinter verbirgt sich gleich eine doppelt gemeinte Abwertung. Das sind spannende Fälle für uns, die wir uns sehr genau anschauen.
Der Deutsche Olympische Sportbund hat dem „Team D“ erstmals einen KI-Filter für die Social-Media-Accounts angeboten. Was halten Sie davon?
Wenn die KI gut trainiert ist, finde ich es zunächst mal gut, wenn schlimme Dinge rausgefiltert und aus- blendet werden. Es ist wichtig, dass Hass keine Bühne geboten wird, denn sonst würden die Grenzen immer weiter verschoben. Ich fände es aber problematisch, diese Grenzen des Sagbaren allein durch eine KI aus- loten zu lassen. Es ist oft ein schmaler Grat zwischen legitimer Kritik und Hass – zumindest aus Sicht der Kritisierten bzw. Angefeindeten. Ich frage mich: Ist das dann noch der öffentliche Diskurs, den wir von Social Media erwarten, wenn wir nur noch den „Daumen hoch“ erlauben? Außerdem hat KI natürlich gerade da ihre Grenzen, wo Hass eben nicht offensichtlich durch Kraft- ausdrücke, sondern sarkastisch oder zynisch zwischen den Zeilen stattfindet.
Auf welcher Plattform haben Sie während der Olympischen Spiele den meisten Hass wahrgenommen?
Facebook ist unter den großen Social-Media-Plattformen offenbar die toxischste, zumindest nach vor- läufigen Erkenntnissen. Auch auf TikTok gibt es sicher grenzüberschreitende Kommentare; aber zumindest nach außen scheint das doch eher eine Gute-Laune-Plattform zu sein.

Sie kooperieren im Rahmen Ihrer Forschung auch mit Spitzensportverbänden wie dem Deutschen Volleyballverband, dem Deutschen Ruderverband oder dem Deutschen Turnerbund. Zieht sich dieser Online-Hass denn wirklich durch alle Sportarten?
Ja. Das kann man tatsächlich so sagen. Ich glaube nur, die Verbände sind unterschiedlich gut aufgestellt, was den Umgang damit angeht. Vielen fehlen schlicht die personellen Ressourcen, um das Problem zu priorisieren. Außerdem sind sie eher punktuell damit konfrontiert, insbesondere im Zuge von Großereignissen. Aber alle, die ich auf der Suche nach Kooperationspartnern für das Projekt kontaktiert habe, beschrieben mir Online-Hass gegen Sportlerinnen und Sportler als relevantes Thema.
Gibt es Unterschiede bei Online-Hass gegen Sportlerinnen und Sportler?
Ja, die gibt es. Männliche Sportler werden eher für ihre Leistungen kritisiert; bei Sportlerinnen sind es häufig frauenfeindliche Kommentare, die den Körper und das Aussehen der Frau angreifen und sie zu sexualisierten Objekten degradieren. Weitgehend unabhängig vom Geschlecht sind rassistische Kommentare, die schwarze Sportlerinnen und Sportler erfahren müssen. Interessant ist, inwiefern Sportlerinnen und Sportler unterschiedlich damit umgehen. Sind Fußballer schon so an Anfeindungen gewöhnt, dass sie selbst explizite Androhungen von Gewalt mittlerweile kaltlassen? Auch das wollen wir in unserem Forschungsprojekt in den kommenden zwei Jahren durch viele Interviews herausfinden.
Ein Blick in die Zukunft: Wird der Hass wieder verschwinden?
Es wird, nicht nur für Sportlerinnen und Sportler, sondern für uns alle wichtiger werden, den Umgang damit zu lernen. Dieser Hass wird wohl leider nicht wieder verschwinden, solange es böse Menschen gibt.
Christoph Klemp





