
I. Der Hass
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat in seiner Zeit als Coach des Fußballvereins Bayern München 450 Morddrohungen erhalten, nachdem die Bayern im April 2022 gegen Villareal aus der Champions League ausgeschieden waren. Sogar seine Mutter wurde bedroht, sagte Nagelsmann bei einem Pressegespräch am 15. April 2022.
Fußballerin Svenja Huth freute sich nach der Weltmeisterschaft in Australien im November 2023 über Nachwuchs. Der offizielle Kanal der DFB-Frauen veröffentlichte auf X (ehemals Twitter) ein Bild der Spielerin mit ihrer Ehefrau und einem Kinderwagen. Unter dem Beitrag vom 27. November 2023 sammelten sich Hasskommentare.
Eishockey-Nationalspieler Moritz Müller wurde bei einem Spiel seines Klubs Kölner Haie gegen Ingolstadt wegen eines Fouls vom Platz gestellt. Auf Instagram schrieb ein Unbekannter am 7. Januar 2024 unter ein Bild Müllers mit seinen drei Kindern, dass er für diese Leistung die Kinder des Sportlers töten würde.
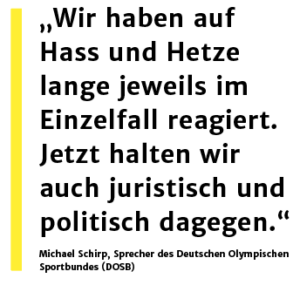
Leichtathlet Owen Ansah ist der erste Deutsche, der die 100 Meter in unter zehn Sekunden lief. Nach seinem Rekordlauf bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig am 29. Juni 2024 hagelte es rassistische Kommentare in den sozialen Medien.
Fußballerin Sharon Beck vom SV Werder Bremen erhielt im August 2024 bei X (ehemals Twitter) eine antisemitische Hass-Nachricht, in der der israelischen Nationalstürmerin und ihrer Familie der Tod gewünscht wird.
Es sind fünf Beispiele aus drei Sportarten, die zeigen: Es sind keine Einzelfälle. Ob Sieg oder Niederlage, freudiges Ereignis oder Rekord. Hassbotschaften sind für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler trauriger Alltag. Die Kommentare sind antisemitisch, rassistisch, homophob, bösartig und bedrohlich.
„Cybermobbing ist bereits seit vielen Jahren ein sehr ernst zu nehmendes Problem“, sagt Ulf Baranowsky, Geschäftsführer der Fußballer-Spielergewerkschaft VDV. Michael Schirp, Sprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), resümiert: „Wir haben auf Hass und Hetze lange jeweils im Einzelfall reagiert. Wir sind aber inzwischen an einen Punkt gekommen, wo das, ebenso wie bloße Bekenntnisse oder Solidaritätsbekundungen mit Betroffenen, nicht mehr ausreicht. Wir halten jetzt auch juristisch und politisch dagegen.“
II. Ein Wendepunkt
Die Weltmeisterschaft der deutschen U17-Fußballer im Winter 2023 in Indonesien markiert einen Wendepunkt im Umgang der großen Sportverbände und Vereine mit dem Thema Hass und Hetze. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte zum Einzug der Nachwuchs-Kicker ins Viertelfinale ein Bild der vier deutschen Nationalspieler Paris Brunner, Charles Herrmann, Almugera Kabar und Fayssal Harchaoui auf seinem Facebook-Account gepostet. Unter dem Bild liefen dermaßen viele rassistische Kommentare ein, dass der DFB sich gezwungen sah, die Kommentarfunktion abzuschalten. Kurz zuvor waren bei der U21-EM in Georgien und Rumänien bereits die deutschen Nationalspieler Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam rassistisch beleidigt worden. Sie hatten jeweils einen Elfmeter im Spiel gegen Israel verschossen. „Wenn wir gewinnen, sind wir alle Deutsche. Wenn wir verlieren, kommen diese Affen-Kommentare“, sagte der damals 18-jährige Moukoko. Die Vorfälle wirkten wie ein Weckruf für die Verbände.
Mit Blick auf sportliche Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und die Olympischen Spiele in Paris intensivierten Sportverbände wie der DFB, der DOSB oder die Deutsche Fußball Liga (DFL) gemeinsam ihren Kampf gegen Hassrede. Denn solche Großereignisse bieten nicht nur den Aktiven eine große Bühne, sondern auch den Verfassern von Hassbotschaften im Netz. „Wer meint, im Stadion oder beim Sport überhaupt sei es okay, da dürfe man auch mal rassistische, homophobe, antisemitische oder muslimfeindliche Sprüche raushauen, der irrt gewaltig“, teilte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann mit, als die großen Sportverbände im Mai 2024 eine neue Allianz aus Verbänden und Strafermittlern vorstellten. „Fair Play endet nicht an der Seitenlinie.“
Böse Fouls in den sozialen Medien gegen Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sollen seitdem verstärkt auf den Schreibtischen der Staatsanwaltschaften landen: Seit Mai 2024 kooperieren die Sportverbände offiziell mit der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main. Die Verbände arbeiten eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und erstatten Strafanzeigen, wenn gewalttätige, rassistische oder diskriminierende Sprache verwendet wird.
Dass die Sorge der großen Verbände begründet war, zeigte sich dann während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und den Olympischen Spielen in Paris. Nach Angaben des hessischen Justizministeriums hat die ZIT allein bis Juli 2024 mehr als 1.000 Hasskommentare gemeldet bekommen und davon mehr als 800 strafrechtlich relevante Hasskommentare identifiziert, die sich allein auf das DFB-Team bezogen. Eine abschließende Auswertung sei derzeit in Arbeit, teilte die ZIT auf Anfrage des WEISSEN RINGS mit. Bei den Olympischen Spielen in Paris registrierte die Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) mehr als 8.500 gezielte Beschimpfungen gegen Athletinnen und Athleten sowie ihr Umfeld.
III. Online-Hass in der Bundesliga
In der Fußball-Bundesliga entstanden zeitgleich mehrere Allianzen aus Justiz, Polizei und Fußballvereinen. In Bayern gibt es eine Kooperation des bayerischen Fußball-Verbandes mit der Münchner Generalstaatsanwaltschaft. Einem Aufruf des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum unter dem Motto „Wer hetzt, verliert“ haben sich sämtliche NRW-Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga angeschlossen, sie kooperieren seit April 2024 mit der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) bei der Staatsanwaltschaft Köln. Der VfL Bochum hatte die Kooperation bereits im Dezember 2023 ins Leben gerufen.
Ex-Bundesliga-Profi Andreas Luthe, der seine aktive Profilaufbahn in diesem Jahr beim VfL Bochum beendete, saß bei der Auftaktveranstaltung auf dem Podium. Der Fußballer erlebte im Januar 2023 selbst, wie es sich anfühlt, das Ziel von Hass und Hetze zu sein. Der Torwart hatte mit dem 1. FC Kaiserslautern, bei dem er damals noch unter Vertrag stand, ein Spiel in Hannover gewonnen. Er selbst hatte mit guten Paraden in der Schlussphase maßgeblichen Anteil an dem Sieg. Eigentlich ein schöner Tag für Luthe, doch es folgte kübelweise Hass. „Bekomme ganz widerliche Nachrichten von @Hannover96-#Fans. Wusste gar nicht, dass Familien den Tod zu wünschen so in Mode geraten ist. Der Trend ist an mir vorbeigegangen…“, schrieb Luthe damals auf seinem Twitter-Account.
Der Verein mit der größten Social-Media-Reichweite unter den an „Wer hetzt, verliert“ beteiligten Klubs ist Borussia Dortmund. Der BVB hat bei Instagram 21 Millionen Follower, bei Facebook 15 Millionen und bei „X“ (ehemals Twitter) fast 4,5 Millionen.

Dortmund, im August 2024. Im Raum „Berlin“ im fünften Stock der Geschäftsstelle des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hängen großformatige Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Jahre 1989. Eines zeigt den jubelnden Kapitän Michael Zorc. Auf einem anderen reckt Andreas Möller im BVB-Trikot den DFB-Pokal in die Höhe, daneben steht lachend Norbert Dickel, der heutige Stadionsprecher des BVB. Mit Anfeindungen auf Social Media mussten sich diese drei ehemaligen Fußballprofis damals nicht beschäftigen. Heute steht das Thema sehr weit oben auf der Agenda des Vereins.
„Ein entschlossenes Vorgehen gegen Hate Speech im Netz ist uns bei Borussia Dortmund enorm wichtig“, sagt Sascha Fligge, Direktor Kommunikation beim BVB, der Redaktion des WEISSEN RINGS. „Dank verschiedener Maßnahmen haben wir die Möglichkeit, die Verfasser von Hasskommentaren strafrechtlich zu verfolgen und unsere Spieler somit noch besser zu schützen. Auch mit Blick auf die Größe unserer Kanäle arbeiten wir weiter daran, unsere Kommentarspalten in den sozialen Medien so sauber wie möglich zu halten.“
Julian Bente aus dem Social-Media-Team und Syndikus-Anwältin Kristina Rothenberger betreuen bei Borussia Dortmund das Projekt „Wer hetzt, verliert“. „Wenn Kommentare oder Nachrichten im Netz nicht mehr bloß freie Meinungsäußerungen sind, können wir jetzt über dieses digitale System Anzeige erstatten“, erklärt Rothenberger. „Wir wollen deutlich machen, dass es bei aller Emotion und Leidenschaft im Sport auch Grenzen gibt – das Internet ist kein rechtsfreier Raum“, ergänzt die Syndikus-Anwältin, beim BVB zuständig für alle rechtlichen Belange auf und neben dem Platz.
„Wer hetzt, verliert“ funktioniert so:
Die Vereine dokumentieren die Fälle, machen Screenshots und sammeln alle verfügbaren Informationen zum Absender der Hassbotschaften. Diese Dokumente werden dann auf dem Computer einfach in einen Ordner geschoben und landen über eine Schnittstelle bei der ZAC. Dort überprüfen die Expertinnen und Experten die angezeigten Posts auf strafrechtliche Relevanz und leiten im Verdachtsfall Ermittlungsverfahren ein. „Insgesamt besteht ein sehr enger Austausch mit den beteiligten Vereinen. Konkrete Sachverhalte werden daher teils im Vorfeld einer Anzeigenerstattung auch telefonisch erörtert“, schildert Staatsanwalt Dr. Christoph Hebbecker, Pressesprecher der ZAC NRW. Doch häufig gestaltet sich die Identifizierung der hinter den Kommentaren stehenden Personen schwierig – nicht zuletzt, weil die Polizei hierbei auf die Kooperation großer Plattform-Betreiber wie Meta oder Google angewiesen ist.
Nach Spielen des BVB werden die Vereinskanäle mit Hunderten Kommentaren geflutet, besonders bei Niederlagen. „Kritik an den Spielern ist völlig in Ordnung, aber sobald es ausfallend wird, reagieren wir“, sagt Julian Bente. „So traurig das ist, es wird gefühlt immer mehr.“ Mehr Kanäle, mehr Follower, mehr Hass. Besonders bedrückend: An Aktionsspieltagen der Deutschen Fußball Liga gegen Rassismus oder Antisemitismus ist der Anteil von Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken besonders hoch. Als Borussia Dortmund in der Saison 2022/2023 in Gladbach im Regenbogen-Trikot als Zeichen für mehr Vielfalt und gegen jede Form von Diskriminierung auflief und das Spiel verlor, folgten mehrere Tausend negative bis beleidigende Kommentare auf der Facebook-Seite des BVB. Auf dem Bild, an dem sich die Leute damals abgearbeitet haben, war lediglich das Trikot zu sehen, auf dem die Logos der Sponsoren in Regenbogenfarben leuchteten. „Das war wirklich krass“, erinnert sich Bente, der an diesem Tag stundenlang am Laptop saß und die übelsten Kommentare händisch ausblenden musste.
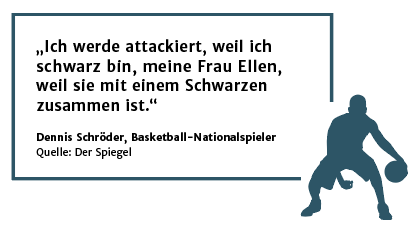
Heute setzt der BVB zusätzlich zum menschlichen Community-Management des Social-Media-Teams auf die Hilfe einer KI, um die Masse der Kommentare auf den klubeigenen Kanälen zu sichten. Das Filterprogramm „GoBubble“ durchsucht Instagram, Facebook und Twitter nach vorgegebenen Wörtern und Emojis und blendet anstößige Beiträge automatisch aus. Der Clou: Während der Kommentar für alle anderen ausgeblendet ist, wird dieser dem Verfasser weiter angezeigt. „So fühlt er sich nicht dazu animiert, weitere Hasskommentare nachzulegen, wie es sonst nach dem Löschen erfahrungsgemäß passiert“, erklärt Bente.
„Oft findet man Hass und Hetze auf unseren offiziellen und öffentlichen BVB-Kanälen, die wir im Social-Media-Team betreuen – aber uns war es besonders wichtig, die Spieler beim Projekt ‚Wer hetzt, verliert‘ mit ins Boot zu nehmen. Denn wir wissen, dass sie in ihren Privatnachrichten noch sehr viel heftiger angefeindet werden als unter unseren öffentlichen Beiträgen“, sagt Bente. Kristina Rothenberger informierte die Spieler von den Profis bis zur U17 über die neue Kooperation. Das seien sehr gute Gespräche gewesen, in denen die Spieler offen erzählt hätten, welche Erfahrungen sie mit Hass und Hetze machen und wie sie damit umgehen. Und das sei sehr unterschiedlich.
„Eine Fußballmannschaft ist sehr divers“, sagt Rothenberger. Das Team vereint Spieler vom 17- bis zum 35-Jährigen, vom Introvertierten bis zum Extrovertierten. Manche glauben, Hass auszuhalten gehöre dazu im Profisport, andere nehmen sich das sehr zu Herzen, wieder andere bleiben den sozialen Netzwerken gleich ganz fern. „Wir wollen schon bei unseren Jugendspielern die Weichen stellen und sie dafür sensibilisieren, dass es keine Schwäche ist, darüber zu sprechen, und dass Beleidigungen und Bedrohungen durch keine Rote Karte, keinen verschossenen Elfmeter oder sonst wie zu rechtfertigen sind“, sagt Rothenberger.
Manchmal staunen Rothenberger und Bente über die Urheber der Hassnachrichten. „Nicht wenige setzen sich sogar hin und schreiben eine E-Mail – teilweise mit Klarnamen“, sagt Rothenberger. „Wir beobachten, dass gerade nach Niederlagen unserer Mannschaft viel Hass und Hetze kommen“, so Bente. „Und es kommt auch nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem Ausland.“
Seit dem Projektstart von „Wer hetzt, verliert“ im Frühjahr 2024 haben die beteiligten Vereine aus der 1. und 2. Liga nach Angaben der ZAC NRW insgesamt 16 Anzeigen erstattet. In zehn Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Von diesen zehn Ermittlungsverfahren wurden fünf eingestellt, da ein Beschuldigter nicht ermittelt werden konnte. In einem Verfahren konnte ein Beschuldigter ausfindig gemacht werden. Das Verfahren wurde an die örtlich zuständige Staatsanwaltschaft Bielefeld abgegeben. In den übrigen Verfahren dauern die Ermittlungen noch an. „Tatvorwurf war zumeist Beleidigung, teils aber auch Bedrohung oder Volksverhetzung“, sagt ZAC-Sprecher Hebbecker.
Acht der 16 bei der ZAC NRW eingegangenen Anzeigen hat Borussia Dortmund gestellt. „Wir konzentrieren uns dabei auf Fälle, bei denen es uns realistisch erscheint, dass diese auch strafrechtlich verfolgt werden können“, erläutert die BVB-Anwältin. Manche Dinge seien zwar schwer erträglich zu lesen, hätten aber noch nicht die Hürde zur Strafbarkeit genommen. Während Bedrohungen oft klar einzuordnen seien, sei das bei Beleidigungen schon schwieriger. Zumal die beleidigte Person laut Paragraf 194 im Strafgesetzbuch selbst einen Strafantrag stellen muss. „Es würde sehr viel vereinfachen, wenn wir das allein als Verein machen könnten, um die Spieler zu schützen“, sagt Rothenberger. Eine rechtliche Hürde, die DFB und DOSB bereits an die Politik adressiert haben.
Im Juni 2024 beschäftigten sich die Justizministerinnen und Justizminister der Länder mit dem Phänomen Hate Speech im Zusammenhang mit sportlichen Wettkämpfen. Die Justizministerkonferenz erkannte dabei eine Zunahme von Hass und Hetze nicht nur im Bereich des Sports, sondern nahm „mit Sorge eine gesamtgesellschaftliche Zunahme von rassistischen, antisemitischen oder sonstigen menschenverachtenden Beleidigungen zur Kenntnis“, wie es in einem ihrer Beschlüsse heißt. Die Justizministerkonferenz bat deshalb Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), bis zu ihrer Herbstkonferenz im November 2024 zu prüfen, „ob Beleidigungen, die einen rassistischen, antisemitischen oder sonstigen menschenverachtenden Inhalt haben oder von derartigen Beweggründen getragen sind (sog. Hate Speech) und damit die Grundwerte eines freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens berühren, unabhängig vom Vorliegen eines Strafantrags verfolgbar sein sollten“. Der Ball liegt jetzt also bei Bundesjustizminister Buschmann.
IV. Die Spitze des Eisbergs

Die Sportpsychologin Marion Sulprizio von der Deutschen Sporthochschule Köln geht davon aus, dass die Dunkelziffer bei von Hass und Hetze betroffenen Sportlerinnen und Sportlern sehr hoch ist. Als Geschäftsführerin von „MentalGestärkt“, einer Initiative zur psychischen Gesundheit im Leistungssport, hat sie am Psychologischen Institut der Sporthochschule direkt mit Betroffenen zu tun. „Wir sehen in der Praxis nur die Spitze des Eisbergs. Der Leistungsdruck im Spitzensport ist ohnehin sehr hoch. Gerade in der Sportwelt wird es leider immer noch viel zu häufig mit Schwäche assoziiert, sich zu outen und zu sagen: Das hat mich sehr verletzt, das setzt mir zu, mir geht’s nicht gut“, sagt Sulprizio. Trainer oder Betreuerinnen sollen von der Verletztheit möglichst nichts erfahren, weil Betroffene fürchten, dann nicht mehr aufgestellt zu werden. Sponsoren sollen es nicht wissen, weil sie abspringen könnten. Kurzum: Es soll nicht öffentlich werden.
Dabei sei die Wucht von Hass und Hetze im Leistungssport nicht zu unterschätzen, sagt Sulprizio: „Früher haben einen die Fans von der Tribüne beschimpft oder mal einen bösen Brief geschrieben. Das waren punktuelle Ereignisse. In Zeiten von Social Media sind Hass und Hetze aber allgegenwärtig.“ Millionen Menschen können bösartige Kommentare zu Leistung, Aussehen oder Gewicht der Sportlerinnen und Sportler lesen. Das könne bei Betroffenen ein massives Gefühl der Ungerechtigkeit und Selbstzweifel auslösen. Bedrohungen seien eine weitere Form digitaler Gewalt. Die Sportpsychologin zählt auf: „Depressionen, Essstörungen oder Angst – die potenziellen Auswirkungen bilden eine breite Palette psychischer Erkrankungen ab.“ „Die Krux ist, dass sie die Social-Media-Kanäle heute für ihre Karriere brauchen. Die können sie nicht einfach ausschalten – da geht es schlicht auch um Reichweiten und Verdienstmöglichkeiten.“ Viele Sportlerinnen und Sportler halten über Social-Media-Accounts Kontakt zu ihren Fans und bauen sich selbst als Marke auf.
V. Auf der Suche nach Auswegen
Wenn der Sport ein Spiegel der Gesellschaft ist, dann wird hier deutlich, dass sich gesellschaftlich etwas massiv verschoben hat. „Es ist sehr offensichtlich, dass da Grenzen verschoben worden sind in Bezug auf Hass und Hetze – auch weil es so vorgelebt wird von populistischen Politikerinnen und Politikern“, sagt Dr. Daniel Nölleke, Juniorprofessor an der Deutschen Sporthochschule Köln. „Weil immer seltener zwischen Fakten und Meinungen getrennt wird. Weil es schnell heißt, das ist ‚Cancel Culture‘ oder ‚Hier wird meine Redefreiheit eingeschränkt‘, sobald etwas gegen Hassrede gesagt wird.“ Dabei spiele die vermeintliche Anonymität im Internet gar nicht die entscheidende Rolle. „Die Leute machen das sehr oft unter ihren Klarnamen“, sagt Nölleke.
„Ich glaube schon, dass man eine Grundhaltung haben muss, dass das in unserer Gesellschaft niemals normal sein darf“, sagte Fußballer Andreas Luthe in einem Interview mit dem SWR. „Ich bin schon der Meinung, dass man Kritik an mir üben darf und ich als Person des öffentlichen Lebens das zu akzeptieren habe“, sagte Luthe zum Auftakt der Allianz „Wer hetzt, verliert“ in Bochum. „Aber sobald es konkrete Drohungen gegen das Leben von mir oder meiner Familie betrifft, dann ist eine Grenze überschritten.“ Er selbst habe die Kommentarfunktion unter seinen Social-Media-Beiträgen abgeschaltet, wenn es wieder mal zu heftig wurde. Peter Schmitt vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) sagt: „Die einen gehen aktiv gegen Diffamierung vor wie Malaika Mihambo. Andere holen sich eine Beratung über den DLV, und wieder andere ignorieren die Posts.“ Die Spielergewerkschaft VDV hat, so erzählt es Geschäftsführer Ulf Baranowsky, aufgrund zahlreicher Hinweise von Spielern unterschiedliche Hilfsangebote entwickelt, von der Rechtsberatung über psychologische Unterstützung bis zu Präventionsschulungen.
Ein ernüchterndes Fazit zog Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann damals im April 2022 bei der Pressekonferenz angesichts der 450 Morddrohungen gegen ihn und seine Mutter: Natürlich könne man das alles anzeigen, aber da werde er nicht mehr fertig. Er lösche diese Kommentare einfach blockweise.
Fußballerin Svenja Huth hat sich mittlerweile für viele völlig überraschend aus der Frauen-Nationalmannschaft zurückgezogen. Die Zeit, so wird sie in einer Mitteilung des DFB zitiert, war „sowohl körperlich als auch mental herausfordernd sowie kräftezehrend, so dass ich für mich zu dem Entschluss gekommen bin, meine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden“. Sie spielt weiter in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg.
Eishockey-Profi Moritz Müller hat den Verfasser der bedrohlichen Nachricht angezeigt. „Man ist ja doch einiges gewohnt und hat schon einiges gelesen über sich selber, aber das war für mich auf jeden Fall noch mal eine Grenze, die dort überschritten wurde“, sagte er der Redaktion des WEISSEN RINGS. „Das hat mich schon erschüttert.“
Werder Bremen hat den antisemitischen Hassbeitrag gegen die Spielerin Sharon Beck selbst öffentlich gemacht. „Wir haben das Vorgehen intern und gemeinsam mit der Spielerin diskutiert und den Entschluss gefasst, den Post unzensiert abzubilden, um zu zeigen, was Jüdinnen und Juden in Deutschland aktuell an antisemitischem Hass erleben müssen“, teilte der Verein auf Anfrage der Redaktion des WEISSEN RINGS mit. „Die Veröffentlichung des Absenders sollte eine abschreckende Wirkung erzielen.“ Sharon Beck selbst sagte: „Leider ist es nicht das erste Mal, dass ich für meine Herkunft angefeindet worden bin. Ich bin dem Verein, allen Verantwortlichen und Fans unglaublich dankbar für diese herzergreifende Unterstützung. Das bedeutet mir und meiner Familie sehr viel.“
Nach den rassistischen Angriffen auf den Leichtathleten Owen Ansah hat sich auch der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) der Kooperation von DFB und DOSB mit der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main angeschlossen. Der Schutz der Athletinnen und Athleten vor Diffamierung, Rassismus und persönlichen Beleidigungen sei dem Verband besonders wichtig, sagt DLV-Mediendirektor Peter Schmitt. Und Owen Ansah? Dem ARD-Mittagsmagazin sagte der deutsche Rekordsprinter, ihn beschäftigten die rassistischen Beleidigungen wenig: „Ich lese mir das gar nicht erst durch. Ich konzentriere mich in meinem Leben sowieso nicht auf die negativen Sachen.“ Und doch fügte er hinzu: „Ich würde mir wünschen, dass die Leute, die das schreiben, einfach damit aufhören. Und dass sie ihre gerechte Strafe dafür bekommen.“

Dass es sich lohnt, Hassbotschaften anzuzeigen und Verfasser ausfindig zu machen, vielleicht auch nur zur Abschreckung anderer, zeigen Beispiele der beiden Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger und Benjamin Henrichs.
Antonio Rüdiger wurde rassistisch beleidigt und wehrte sich mithilfe seines Vereins Real Madrid juristisch gegen den Verfasser der Hassbotschaften. Der Mann hatte unter verschiedenen Pseudonymen in der Online-Ausgabe der spanischen Fußball-Zeitung „Marca“ rassistisch gegen den Spieler gehetzt. Spanische Behörden ermittelten den Verfasser. Ein Gericht verurteilte ihn zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe. Real Madrid bedankte sich in einer Mitteilung über den Fall bei Fans, die die Kommentare entdeckt und den Behörden sowie dem Verein gemeldet hatten.
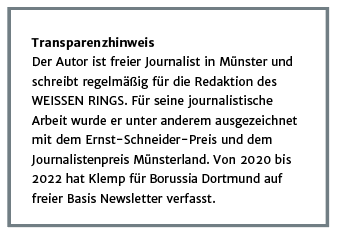
Benjamin Henrichs von RB Leipzig hat rassistische Angriffe und Nachrichten der Kategorie „Ich werde dich und deine Familie finden …“ erhalten, wie er selbst bei TikTok öffentlich machte. Besonders die Sprachnachrichten hätten ihn hart getroffen, erzählte Henrichs dem YouTuber Bilal Kamarieh, weil er da realisiert habe,
In einem weiteren Fall wählte Henrichs einen anderen, eher ungewöhnlichen Weg: Er recherchierte, so erzählt er es auf YouTube, mit Team-Kollegen die Telefonnummer der Familie des erst 16-jährigen Hass-Kommentators und rief kurzerhand den Vater an. „Weißt du, was dein Junge im Internet macht? Weißt du, was der mir schreibt?“ Henrichs las ihm die Nachricht vor. Der Vater sei geschockt gewesen und habe sich für seinen Jungen geschämt. Der Mann habe seinen Sohn von der Schule abgeholt. Am Telefon entschuldigte sich der Junge kleinlaut bei Henrichs. „Ich habe ihm gesagt: Schämst du dich nicht? Dein Vater schämt sich für dein Verhalten.“ Der Junge, der im Internet so deutliche Worte voller Hass gegen Henrichs gefunden hatte, habe im persönlichen Gespräch am Telefon kein Wort mehr rausgebracht.
Christoph Klemp





