Kinderarzt, sagt der Kinderarzt, bleibt man, bis man unter die Erde kommt. Wenn das stimmt, dann wird Dr. Ralf Kownatzki, der 1979 Kinderarzt wurde, all das, was er in seinem Berufsleben erlebt hat, erst los, wenn er irgendwann von dieser Welt gegangen sein wird. Erst dann wird die Erinnerung an die rund 30.000 kleinen Patienten ausgelöscht sein, an die großen und kleinen Notfälle des ganz normalen Lebens. Und an die Dinge, die man sonst nur aus der Zeitung kennt. Kindesmisshandlungen, extreme Vernachlässigungen, Grausamkeiten. Von denen man als Normalbürger in den Medien liest und erschauert. Aufschaut und dann froh ist, dass das eigene Leben kein Thema in der Zeitung ist.
Um solche Fälle und um die Konsequenzen daraus geht es in diesem Text. Und darum, ob das bestehende Hilfesystem ausreicht, um Fälle von Kindesmisshandlungen zu vermeiden. Kownatzki kann von diesen Fällen erzählen. Sehr routiniert, fast wie ein Rechtsmediziner, der erläutert, was er da vor sich auf dem Tisch liegen hat. Er zieht die Fälle „aus dem Hut“, wie er selber sagt, da er sie schon öfter vorgestellt hat.
Einerseits, weil sie sein Berufsleben berührten und damit zu realen Fällen wurden. Andererseits, weil der Kinderarzt seit 15 Jahren ein Ziel verfolgt, das er ohne diese echten, selbst erlebten Fälle nicht hätte: Kownatzki will seit 2005 möglich machen, dass sich Ärzte bei einem Verdachtsfall wegen Kindesmisshandlung miteinander austauschen können, ohne gegen die berufsbedingte Schweigepflicht zu verstoßen. Er will es Kindseltern schwer machen, einfach den Arzt zu wechseln, wenn sie regelmäßig ihr Kind misshandeln oder vernachlässigen und dann an verschiedenen Stellen die immer gleiche Geschichte erzählen, wie es zu dieser oder jener Verletzung kommen konnte.
Die kleine Nathalie stirbt
Das geht nicht, sagen Datenschützer. Das höhlt bestehende Hilfestrukturen aus, sagen Menschen, die in diesen Strukturen arbeiten. Das könnte Eltern davon abhalten, überhaupt zu einem Kinderarzt zu gehen, geben andere zu bedenken. Da mache ich lieber nicht mit, denkt sich schlussendlich ein Arzt, der all das hört; das könnte mich meine Approbation kosten.
Das sind falsche Ansätze, findet Kownatzki. Er und seine Mitstreiter seien nur ein Mosaiksteinchen. Sie wollten Sachverhalte klären und ein Filter sein. Rausfiltern, wann ein Kind misshandelt wird. Misshandlung oder Vernachlässigung haben, sagt der Arzt, einen chronischen Verlauf, vergleichbar mit einer Krankheit. Und wie bei einer chronischen Krankheit die Früherkennung hilft, so soll bei Kindesmisshandlung die Früherkennung helfen. Das sei das Ziel.
2005
In Duisburg, dem Ort, an dem er praktizierte, sterben vor 15 Jahren in einem Jahr fünf Kinder. Unabhängig voneinander. Die Kinderärzte der Stadt, die vierteljährlich zu sogenannten Qualitätszirkeln zusammenkommen, laden daraufhin die Kripo ein, die Staatsanwaltschaft und die Rechtsmedizin und lassen sich die Fälle vorstellen. Letztlich bleiben damals, so erzählt das heute Kownatzki in seinem Wintergarten, zwei Erkenntnisse übrig: Bei zwei der fünf Kinder, „und das war mit am tragischsten“, hätte eingegriffen werden können, wenn man mehr gewusst hätte.
Nathalie
Nathalie zieht mit ihrer Familie von Bremen nach Duisburg. Im Norden ist sie dem Jugendamt bekannt, hier im Westen der Republik nicht. Das Mädchen wird geschlagen, malträtiert und ans Bett gefesselt. Die U9-Untersuchung, eine Standarduntersuchung eines mindestens fünfjährigen Kindes, findet nicht statt. Nathalie stirbt kurz darauf, sie erliegt den Schlägen im eigenen Elternhaus, es muss das Ende eines jahrelangen Martyriums gewesen sein.
Ihr Vater versucht ihre Leiche dann in Säure aufzulösen, was nicht gelingt. Nach zwei Tagen bringt er den Körper in einer Tragetasche und mit einem Fahrrad zum Autobahnkreuz Kaiserberg. Da vergräbt er das Kind. An diesem Autobahnkreuz treffen sich die A3 und die A40. Und es ist Kownatzkis täglicher Weg zu seiner Arbeit. Er wird in den Folgejahren oft an das Kind denken.
„Wenn die U9 stattgefunden hätte“, kurze Pause, „hätte, hätte“, wieder kurze Pause, das Gehirn fügt „Fahrradkette“ ein, „hätte man dem Kind helfen können.“ Der Arzt sagt „man“ und meint die Kinderärzte, denen bei der U9-Untersuchung, in deren Fokus die sprachliche Entwicklung des Kindes steht, die massiven Misshandlungsspuren hätten auffallen müssen. Verpflichtend sind die U-Untersuchungen heute nur in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Die Vorsorge hatte nicht stattgefunden, darüber hinaus war die Informationskette unterbrochen, „das Duisburger Jugendamt kannte den Fall nicht“.

Problem „Doktor-Hopping“
Collin
Collin wird nur fünf Monate alt. Auch er wird geschlagen und misshandelt, letztlich verdurstete das Kind. Klar zu sehen ist bei der Obduktion, dass der Körper des Kindes mit Hämatomen übersät ist. Mit Collin sind verschiedene Kinderärzte beschäftigt, die Eltern wechseln die Ärzte, um nicht aufzufallen. Wenn ein Kind einmal „die Treppe oder vom Wickeltisch herunter- oder aus dem Kinderwagen herausgefallen“ ist, schöpft ein Kinderarzt Verdacht. Kommt so etwas erneut vor, erhärtet sich der Verdacht – und um dem zu entgehen, wechseln Eltern den Arzt. Doktor-Hopping nennt sich das Phänomen.
„2.10.6 Differentialdiagnose Kindesmisshandlung/kindlicher Unfall
Bei kaum einem Gewaltdelikt sind die Vertuschungsmöglichkeiten so groß wie bei Kindesmisshandlungen. Der Täter ist meist der Betreuer und entscheidet selbst über Arztbesuche. Das Opfer kann sich zumeist nicht oder nur unzureichend artikulieren. Die Diagnose der Kindesmisshandlung findet dabei in einem erheblichen Spannungsfeld statt. (…) Fast jeder Einzelbefund kann letztlich auch durch einen Unfall erklärt werden. Die eindeutige Diagnose ergibt sich aus der Vielzahl ungewöhnlicher Verletzungen und insbesondere aus eindeutig mehrzeitig entstandenen Verletzungen.“
(Aus „Rechtsmedizin systematisch“, 2. Auflage)
Ein Arzt und ein Patient haben im Moment des Aufeinandertreffens ein Verhältnis, und es liegt in der menschlichen Natur, dass das nicht immer gelingt. Wenn deswegen ein Patient seinen Arzt wechselt, ist das möglich. Anderer Arzt, neuer Versuch.
Doch Doktor-Hopping aus Verschleierungsgründen ist das, was Kownatzki unterbinden will. Er hat es selber erlebt, auch in diesem Jahr 2005, ein anderer Fall, nicht tödlich, aber schlimm genug: ein Kleinkind, zwei Jahre alt und dem Jugendamt bekannt, weil ein Telekom-Techniker in die Wohnung der Familie geht, desolate Verhältnisse vorfindet und sie dem Jugendamt meldet. Drogenhintergrund bei den Eltern und ein Kampfhund, dem es besser geht als dem Kind.
Das Kind wird von den Eltern dann in der Praxis vorgestellt, die Kownatzki mit einer Kollegin betreibt: Vorgeschichte unbekannt, zuvor wurde es bei einem anderen Kinderarzt behandelt, es ist untergewichtig. Vereinbarte Folgetermine in der Praxis in den sich anschließenden Sommerferien werden nicht eingehalten. Kurz darauf kommt es zu einem Streit in der Wohnung. Nachbarn rufen die Polizei. Die Beamten finden das Kind, gefesselt an einen Heizkörper, Brandwunden an den Füßen und im Stirnbereich.
Ärzte wollen eine Art „Kinder-TÜV“
Wer zum Beispiel juristische Akten liest, kann in der dort gepflegten juristischen Fachsprache eine ihr eigene Poesie finden. Bei Ärzten gibt es das nicht, hier regiert der ICD-10, ein Diagnoseschlüssel, seit 1994 im Einsatz. Krankheiten oder ihre Diagnosen werden codiert. C25.9 etwa liest sich nicht ganz so fürchterlich wie „Krebs, Bauchspeicheldrüse“, und T74.1 ist für den Laien nur eine Kombination aus einem Buchstaben und drei Zahlen. Übersetzt stehen sie für Kindesmisshandlung. T74.0 heißt Vernachlässigung.
Die Mischung aus Kindstötungen und den T74-Codes im Jahr 2005 in Duisburg bringt eine Gruppe von Kinderärzten zu zwei für sie logischen Schlussfolgerungen: Es braucht in Zukunft eine Art „Kinder-TÜV“, eine zwingende Verpflichtung von Staats wegen, Kinder regelmäßig untersuchen zu lassen. Bei einem Auto, um im Bild zu bleiben, gibt es das ja auch. Nur ist es bei einem Auto letztlich egal, wann oder wo es welchen Schaden erlitten hat. Bei einem Kind nicht.
„Wenn ich die Vorbefunde nicht habe, kann ich nicht richtig arbeiten.“
– Dr. Ralf Kownatzki
Duisburg startet Projekt RISKID
Was zur zweiten Folgerung der Duisburger Gruppe führt: ein Informationssystem für Vorbefunde, wenn Eltern den Kinderarzt wechseln und der Verdacht von Misshandlung,
Vernachlässigung oder Missbrauch im Raum steht. Der Gedanke war: Kommt ein Kind zum ersten Mal in eine Praxis, und da ist ein Verdacht im Raum, dann soll sich der Arzt oder die Ärztin mit dem zuvor behandelnden Arzt austauschen können, denn „wenn ich die Vorbefunde nicht habe, kann ich nicht richtig arbeiten“, sagt Kownatzki.
Falls ein Kinderarzt den begründeten Verdacht hat, einen Fall von Kindesmisshandlung vor sich zu haben, konnte er sich 2005 und auch heute an das zuständige Jugendamt wenden. Das ist der reguläre Weg. Nur: Dort bekommt er keine Vorbefunde. Und was nach einer solchen Meldung geschieht, weiß er auch nicht immer. Das stellt sich jüngst gerade in der Corona-Pandemie als hochproblematisch heraus.
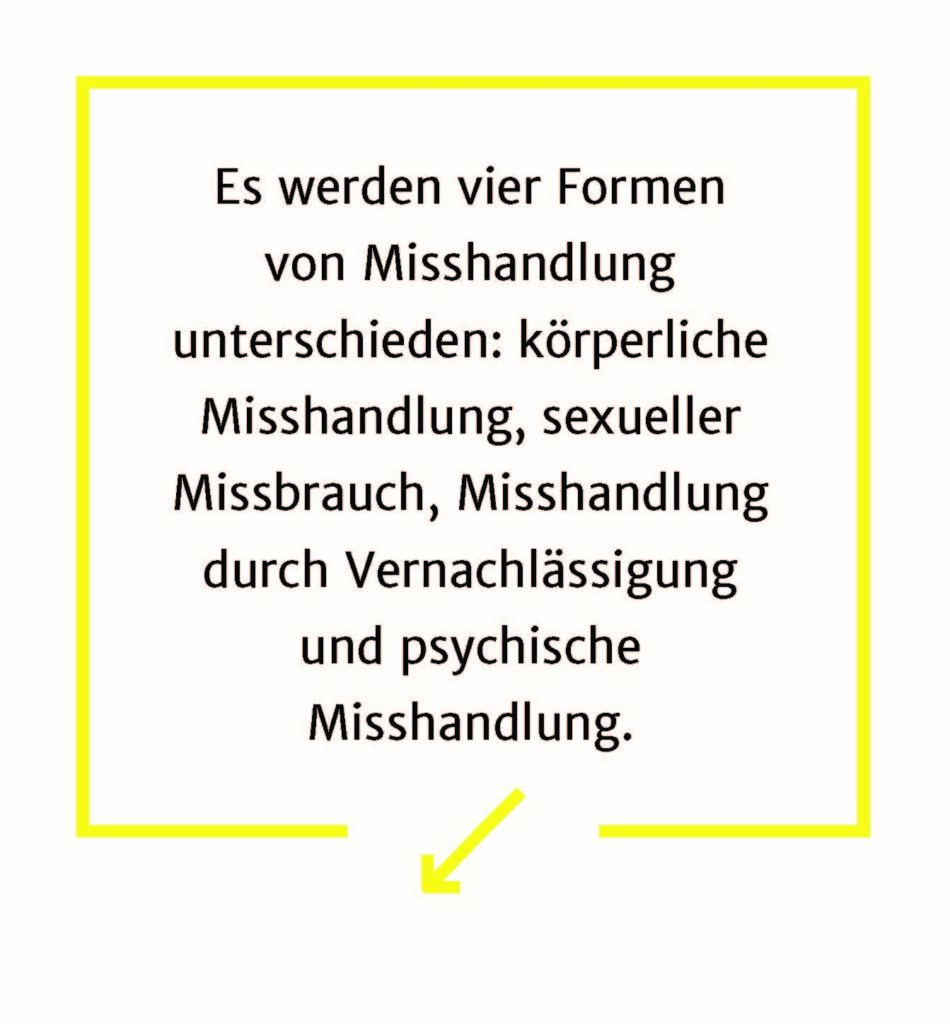
In Duisburg machen sie sich 2005 an die Arbeit und starten das Projekt RISKID. RISKID bedeutete ursprünglich „Risikoinformationssystem Duisburg“. „Wir taten so, als würden wir alle in einer großen Gemeinschaftspraxis arbeiten.“ Nach anderthalb Jahren steht das System. Auf lokaler Ebene funktioniere das gut. Kinderärzte wie Kownatzki sind beteiligt.
Aber auch Heinz Sprenger, erster Kriminalhauptkommissar, er leitet damals das für Gewalt und Tötungsdelikte zuständige Kommissariat in der Stadt. Im Internet findet sich ein drastischer Dokumentationsfilm, darin ist Sprenger zu sehen, wie er zum Beispiel am Kreuz Kaiserberg steht und über den Fall Nathalie spricht. Er zeigt Bilder von Gewalt auf Kinderkörpern und sagt sinngemäß, er zeige diese Bilder, damit die Öffentlichkeit sehe, womit sich Polizei und Ärzte beschäftigen. Der Film heißt „Wir sind doch Kinder“, er ist nur schwer zu ertragen.
Später, als das Projekt RISKID größer wird und über Duisburg hinauswächst, wird das Projekt umbenannt in „Risikoinformationsdatei“. Was aus heutiger Sicht ein „Rohrkrepierer“ war, wie der Arzt sagt. Datei ist ein fieses Wort, dort speichert man Daten, was wiederum nach Datenschutz schreit.

Fünf Kinder sterben in Schleswig-Holstein
Im Jahr 2007 sterben in Schleswig-Holstein fünf Kinder. Auch hier stehen die Fälle in keinem Zusammenhang. Auch sie kommen durch ihre Eltern zu Tode. Misshandelte Kinder werden wieder mal ein Medienthema, erst gibt es Fernsehaufnahmen für „Report“ in Kownatzkis Praxis, dann ruft die Redaktion von „Anne Will“ an. Und der Arzt aus Duisburg sitzt auf ihrer Studiocouch. RISKID, bisher eine lokale Initiative von Duisburger Kinderärzten, wird bekannter.
Es entstehen weitere Ableger, wie kleine Inseln, in Bonn etwa oder Salzgitter. Und, so sagt es Kownatzki, „es formierten sich die Bedenkenträger“. Ein Rechtsgutachten kommt zu dem Schluss, dass das so, wie sie es bei RISKID machen, nicht geht. Ein Verstoß gegen die ärztliche Schweigepflicht ist es bereits, wenn Ärzte irgendwem, und sei es einem anderen Arzt, erzählen, wer bei ihnen die Praxis besucht.
Es erscheint ein kleiner und wohlwollender Artikel in der Fachzeitschrift Sozialpädiatrie. Dann, in der kommenden Ausgabe, eine deutlich längere und erstaunlich scharfe Widerrede. Darin heißt es unter anderem, dass das „Prinzip RISKID einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft“ widerspreche.
RISKID arbeitet seit seinem Beginn mit einer Einverständniserklärung der Eltern. Das gibt den Ärzten eine Sicherheit, sie haben eine Unterschrift. Aber eben auch die Unterschrift eines potenziellen Misshandlers, das sei eine „ziemliche Krücke“, findet der Arzt. Außerdem stellen sie das System auf eine sogenannte Containerlösung um. Jeder Arzt stellt seine Verdachtsfälle in eine eigene Datei ein, auf die nur er Zugriff hat, das ist sein Container. Erst wenn ein Patient mit dem gleichen Namen und Geburtsdatum in einem anderen Datencontainer gespeichert wird, können die Mediziner sich austauschen.
Doch die Zweifel bleiben, ob das alles so rechtens ist, das Projekt kommt ins Stocken. Die Zahl der Kinderärzte, die sich beteiligen, stagniert bis heute bei rund 270. Die Frage, was höher zu bewerten ist – die ärztliche Schweigepflicht oder der Austausch unter Ärzten bei Hinweisen auf eine Kindesmisshandlung, – ist spätestens jetzt eine politische geworden.

In Düsseldorf, an einem von vielen langen Fluren m Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) des Landes Nordrhein-Westfalen, liegt das Büro von Heike Reinecke. Reinecke ist eine angenehme Gesprächspartnerin, schaufelt für das Thema RISKID trotz eines durch Corona sehr engen Terminplans an einem Freitagmittag ein Zeitfenster frei.
Reinecke ist Ministerialrätin, leitet im MAGS das Referat Öffentlicher Gesundheitsdienst und kennt RISKID schon gute fünf Jahre. Damals war NRW noch rot-grün regiert, die Opposition brachte eine parlamentarische Initiative auf den Weg. „Interkollegialer Austausch in der Ärzteschaft“ lautete die Überschrift. Das, was RISKID will.
Es wurde ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben, diesmal von der Landesregierung. Auf 67 Seiten kommen zwei Professoren der juristischen Fakultät Düsseldorf zu zwei Schlüssen. Erstens kommen sie „zu dem Ergebnis, dass ein kinderärztlicher Informationsaustausch bei einem vagen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung – ohne Einwilligung der Eltern oder Einschaltung des Familiengerichtes – eine nach gegenwärtigem Recht nicht gerechtfertigte Schweigepflichtsverletzung darstellt“. Zweitens stellen sie fest, dass eine neue beziehungsweise ergänzende Regelung nur bundeseinheitlich erlassen werden könne.
NRW schiebt den Riegel vor
Dennoch kündigt 2017 die neue schwarz-gelbe Landesregierung in NRW in ihrem Koalitionsvertrag an, „den interkollegialen Ärzteaustausch zur Verhinderung von doctor-hopping und Gewalt gegen Kinder (zu) ermöglichen und den Ärztinnen und Ärzten Rechtssicherheit (zu) geben“. NRW will dem Doktor-Hopping einen Riegel vorschieben, so scheint es. Es folgen ein paar Schlagzeilen, dann wird es wieder ruhiger zu dem Thema.
„Es gibt“, sagt Reinecke in ihrem Büro in Düsseldorf, „ein empfundenes Defizit in der Ärzteschaft.“ Was könne man tun, ohne sich angreifbar zu machen? Zu dem Thema habe es mehrere Anhörungen im Landtag gegeben, letztlich, da sei man sich einig, sei der Handlungsdruck bei dem Thema groß. Übergeordnet könne das nur auf Bundesebene gelöst werden.
In Nordrhein-Westfalen, wo alles seinen Anfang nahm, entschied man sich für das KKG, das „Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen“. Begonnen im Frühjahr 2019, soll das KKG laut Eigenbeschreibung medizinisches Personal in Fragen rund um den Kinderschutz beraten und Anlaufstelle sein. „So soll“, heißt es auf der Homepage, „der medizinische Kinderschutz für ganz NRW flächendeckend und maßgeblich verbessert werden“.
Gute zwei Millionen Euro flossen als Fördersumme, Hauptstandort ist das das Institut für Rechtsmedizin der Universitätsklinik in Köln. Parallel dazu wurden vom Land 13 sogenannte Kinderschutzambulanzen finanziell gefördert, etwa 330.000 Euro kamen vom Land, um etwa Personalkosten zu tragen.
Heike Reinecke sagt, das Kompetenzzentrum sei eine Möglichkeit, „zu gesicherten Diagnosen zu kommen und den weiteren Prozess zu unterstützen“. Damit habe man ein funktionierendes System in NRW geschaffen. „Ärzte“, sagt die Ministerialrätin dann noch, „sehen das wahrscheinlich anders.“

Der Arzt Kownatzki sieht das tatsächlich anders. Die anonymen Beratungen, die das KKG anbietet, gebe es doch schon seit Ewigkeiten. Und wenn dann ein Fall von Kindesmisshandlung bekannt wird, wird das Jugendamt eingeschaltet. Das schicke dann eine Hilfskraft in die betroffene Familie, eine sozialpädagogische Familienhilfe, die bei Subunternehmern angestellt ist. „Deren Qualität ist, gelinde gesagt, sehr unterschiedlich.“ Supervisionen etwa müssten zwingend durchgeführt werden, fänden aber nicht statt. Und Kinderschutzambulanzen seien eine feine Sache. Doch wenn ein Kind dort vorgestellt wird, sei es ja schon rausgefiltert worden, und es stehe nicht als Verdachtsfall im Raum. RISKID gehe es darum, der Filter zu sein.
Kownatzki: „Politik vermeidet Änderungen“
Kownatzki hat seit dem Jahr 2005 viel gelernt. Über den eigenen Weg und eigene Fehler etwa. Heute weiß er, dass er deutlich mehr Rücksichten auf politische Befindlichkeiten nehmen und sich mehr Bündnispartner suchen würde, wenn er noch einmal ins Jahr 2005 zurückreisen und von vorne beginnen könnte.
Er hat aber auch etwas über den Politikbetrieb in Deutschland gelernt: „Die Politik gibt gerne Geld aus, wenn sie glaubt, damit ein Problem lösen zu können. Die strukturelle Lösung aber, bei der unterschiedliche Meinungen gehört und auf deren Grundlage dann entschieden wird, wird nur sehr ungern angegangen. Weil dann für diese Entscheidung eine Verantwortung entsteht, für die man einstehen muss.“
Prof. Dr. Jörg Fegert ist Kinder- und Jugendpsychiater, Hochschullehrer, er ist einer der führenden deutschen Trauma-Experten, leitet die Medizinische Kinderschutzhotline und ist, unter anderem, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen der Bundesregierung.
Wenn man ihn zum Thema „interkollegialer Austausch unter Kinderärzten“ fragt, sagt er am Telefon: „Eine breite Debatte zu dem Thema halte ich für absolut notwendig.“ Generell zustimmen will er aber nicht. Die ärztliche Schweigepflicht sei ein hohes Gut, auf das sich die Eltern verlassen und „mit der wir auch viel Gutes im Kinderschutz bewirken können. Wenn man sich darüber hinwegsetzt, muss das an enge Grenzen gebunden sein.“
„Wir haben hier eine ganz wichtige Stellung. Und der müssen wir gerecht werden durch ethisch verantwortbare Entscheidungen.“
– Prof. Dr. Jörg Fegert
Güterabwägung ist das Wort, das Fegert in dem Gespräch häufig verwendet: „Es braucht einen konkreten Anlass und eine Güterabwägung, ob ich mit Kollegen Kontakt aufnehmen muss.“ Wenn der Arzt verpflichtend prüft, ob das dem Kindeswohl dient und ob er das Kind nicht hinreichend allein schützen kann, wenn also so eine Güterabwägung stattgefunden hat, dann würde er, sagt Fegert, sich für eine Befugnis zum Austausch aussprechen.
Aber er sagt auch: „Ich habe immer Angst vor den etwas zu einfachen Lösungen, die die persönliche Verantwortung des Handelnden der Heilberufe quasi relativiert. Wir haben hier eine ganz wichtige Stellung. Und der müssen wir gerecht werden durch ethisch verantwortbare Entscheidungen.“
Laschet packt das Thema Sicherheit an
Armin Laschet ist Politiker, NRW-Ministerpräsident mit weiterführenden Ambitionen. Als er 2017 noch Oppositionsführer in Düsseldorf war, sah er die Zeit gekommen, sich um das Thema Sicherheit zu kümmern. Er berief die Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein- Westfalen“ ins Leben. Sie sollte die Sicherheitsarchitektur des Bundeslandes überprüfen, Schwachstellen analysieren und konkrete Vorschläge ausarbeiten.
Das als Bosbach-Kommission bekannt gewordene 15-köpfige Expertengremium legte Anfang August 2020 seinen Abschlussbericht vor, 150 Seiten stark. Es geht um verschiedene Kriminalitätsarten, Empfehlungen zu verschiedenen Tätergruppen, Opfergruppen und Vorschläge zur Zusammenarbeit.
Der Abschlussbericht ist ein Ritt durch die Exekutive. Und es findet sich im Anhang A unter der Überschrift „Besserer Schutz vor Kindesmissbrauch“ auch eine Passage mit einer Handlungsempfehlung zu einer „Einführung eines interkollegialen Ärzteaustausches und einer Verdachtsfalldatenbank“. Das eingeführte Kompetenzzentrum löse nur einen Teil des Problems, heißt es dort. Die Einrichtung einer Datenbank sei zielführend, „in welche Fälle eingepflegt werden können, bei denen erst bei Häufung ein konkreter Verdacht anzunehmen wäre.“ Was eine Änderung des Kinderschutzgesetzes erfordern würde. Weiter heißt es: „Bei der praktischen Umsetzung dürfte sich eine Orientierung an ‚riskid‘ anbieten, einer Onlinedatenbank für Ärzte.“ Es ist ein Vorschlag, ausgearbeitet von Experten. Mehr nicht.

Schutz vor Kindesmissbrauch ist ein großes politisches Thema geworden, es gab die Fälle in Bergisch Gladbach, Lügde und Münster, die, so sieht es auch Ministerialrätin Reinecke, die Einschätzungen zu dem Thema verändern werden. Da würde ihr auch Kownatzki zustimmen, Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung seien keine Tabuthemen mehr, die Sensibilität für das Thema habe gesamtgesellschaftlich zugenommen. Doch wer sich mit dem Thema einer Verdachtsfalldatenbank auseinandersetzt, stößt schnell auf Bedenken.
Werden Eltern, die ihr Kind misshandeln und die Gefahr sehen, in so einer Datenbank zu landen, überhaupt noch zum Kinderarzt gehen?
Haben Krankenkassen nicht die Informationen, wenn Eltern öfter den Kinderarzt wechseln?
Wissen Schulen nicht mehr, müsste man die nicht besser einbinden?
Haben wir in Deutschland nicht ein brauchbares System? Und würde das durch die Einrichtung einer Parallelstruktur wie RISKID nicht geschwächt werden? Wie viele Fälle von Doktor-Hopping gibt es überhaupt?
Kownatzki kennt die Fragen, er hat für fast jede eine Antwort: Seiner Erfahrung nach gehen auch Eltern, die ihr Kind misshandeln, zum Arzt, vor allen Dingen, wenn es zwei Elternteile gebe. Und in seiner Praxis in Duisburg arbeiten sie mit einer Einverständniserklärung der Eltern, von etwa 1.500 Elternteilen hätten vielleicht zehn nicht unterschrieben.

Krankenkassen hätten vermutlich die Informationen, die man bräuchte, aber hier sei die Frage, wann sie die bereitstellen würden. Und es gehe ja darum, rechtzeitig eingreifen zu können. Bei der Einbindung von Schulen stünde man vermutlich vor sehr viel größeren Datenschutzschwierigkeiten. Und das System des Kinderschutzes in Deutschland sei mindestens verbesserungswürdig, das hätten ihn seine Berufsjahre gelehrt.
Auf die Frage, wie viele Fälle es gibt, hat Kownatzki keine Antwort. Er hat gesucht und gefragt, ob es irgendwo eine Erhebung zu dem Thema gibt, er hat nichts gefunden. „Es gibt keine Zahlen. Aber wir haben Fälle in unserem Fundus.“
Wieso Kownatzki nicht ans Aufgeben denkt
Kownatzki, der ruhig spricht, gut erzählen kann, bei Antworten oft ins Große und Ganze und Grundsätzliche geht, um dann wieder auf den Kern der eigentlichen Frage zurückzukommen, stockt nur am Ende des Gesprächs. Wieso er, der kurz vor der Rente steht, weiterhin versucht, eine Gesetzesänderung zu erreichen, wenn ihm das seit 15 Jahren nicht gelungen ist?
Kownatzki schweigt länger. In seinem Wintergarten, aus dem man in den kleinen Garten sehen kann. Schweigt weiter. Denkt nach. Vielleicht über die letzten Jahre, vielleicht über die letzte Frage, vielleicht über Nathalie oder Collin oder wie sie alle hießen.
„Die Republik lebt doch gut mit zwei bis drei toten Kindern pro Woche“, sagt er, es ist ein einziger kurzer Moment in dem langen Gespräch, in dem er zynisch wird. Seine Augen werden wässrig.
„Wir sind immer als Erste am Tatort, aber meist zu spät. Die Täter zu überführen gelingt fast immer, die Opfer zu retten fast nie.“
– Heinz Sprenger
Heinz Sprenger, der Weggefährte bei RISKID und Gründungsmitglied, ist inzwischen verstorben. Auf einem Flyer des Vereins ist ein Foto von ihm zu sehen. Klassischer Polizist mit Schnäuzer. Sprenger wird auf diesem Flyer des Vereins mehrfach zitiert, ein Zitat ist in Versalien gesetzt: „Wir sind immer als Erste am Tatort, aber meist immer zu spät. Die Täter zu überführen gelingt fast immer, die Opfer zu retten fast nie!“
Was er da eigentlich mache, habe er sich schon selber oft gefragt, sagt Kownatzki zum Schluss. In den Momenten, wenn sich es anfühlt, als würde er in einem tiefen Loch sitzen und es würde nicht weitergehen. Letztlich sei es doch ganz einfach: Es müsse eine Gesetzesänderung her. Solange die Chance darauf besteht, werde er sich weiter reinknien.
Tobias Großekemper





