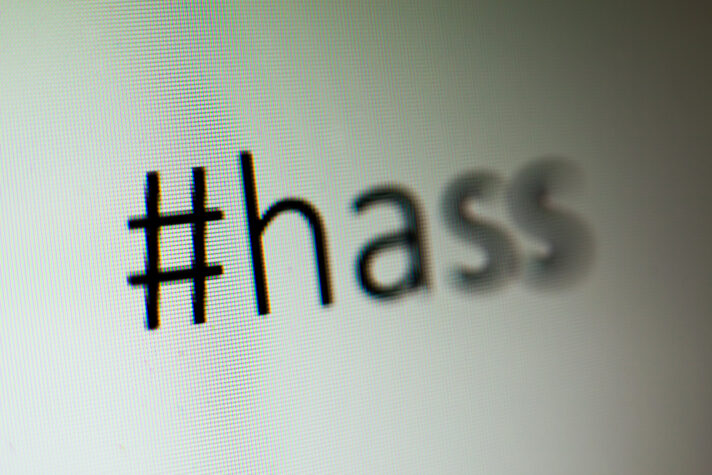Auf Taten folgen manchmal Worte. Zum Beispiel: Ehrenmord. Man weiß sofort, was damit gemeint ist. Seit zwölf Jahren steht der Begriff im Duden. Und das, obwohl Ehrenmorde sehr, sehr selten sind. Was aber löst der Begriff Femizid im Kopf aus? Erst seit einem Jahr kennt der Duden das Wort. Es steht für „tödliche Gewalt gegen Frauen oder eine Frau aufgrund des Geschlechts“. Zum Vergleich: In Deutschland gibt es weniger als eine Handvoll sogenannter Ehrenmorde pro Jahr – aber mehr als hundert Taten, die man als Femizide bezeichnen kann.
Erstmals öffentlich geäußert hat den Begriff Femizid die südafrikanische Feministin und Soziologin Diana E. H. Russell im Jahr 1976 beim Internationalen Tribunal zu Gewalt gegen Frauen in Brüssel. 1992 veröffentlichte sie zusammen mit Jill Radford das Buch Femicide: The Politics of Woman Killing. Über Kanada, die USA und Lateinamerika verbreitete sich der Begriff weltweit. Die Vereinten Nationen nutzen ihn, die Weltgesundheitsorganisation WHO ebenfalls. Die Bundesregierung lehnt das ab. Noch.
Im Familienausschuss des Bundestages gab es im Frühjahr dieses Jahres eine öffentliche Anhörung von Expertinnen und Experten zur Benennung und systematischen Erfassung von Femiziden in Deutschland. Die Sozialwissenschaftlerin Monika Schröttle sagte: „Dinge, die wir nicht benennen, werden auch nicht als solche gesehen.“ Motive der Täter seien „patriarchalische Kontrolle, Dominanz und Besitzansprüche“. Diesen Hintergrund gelte es zu erkennen. Schröttle leitet die Forschungs- und Beobachtungsstelle Geschlecht, Gewalt, Menschenrechte am Institut für empirische Soziologie (IfeS) in Nürnberg und setzt sich bereits seit 2014 dafür ein, den Begriff Femizid zumindest in der politischen Diskussion zu verwenden.
Dr. Leonie Steinl vom Deutschen Juristinnenbund (djb) fügte hinzu, der Begriff betone den strukturellen Charakter dieser Taten. Es seien eben keine individuellen Probleme, keine Familiendramen, keine Eifersuchtstragödien, sondern die schwerste Form von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen. Die Einführung des Begriffs und die systematische Auswertung und Dokumentation von Femiziden könnten dabei helfen, solche Tötungsdelikte besser zu verstehen und zu verhindern, sagte die Berliner Rechtsanwältin Christina Clemm, die sich seit Jahrzehnten im Berlin-Kreuzberg um Frauen kümmert, die zum Teil schwerste Gewalttaten überlebt haben.
Heike Herold vom Verein Frauenhauskoordinierung (FHK) erinnerte an die Diskussion über häusliche Gewalt. Seitdem der Begriff eingeführt und auch in der Alltagssprache angekommen sei, habe sich vieles für den Schutz der Frauen verbessert. Es gebe mehr Hilfsangebote und ein öffentliches Bewusstsein dafür.
Es gibt auch andere Sichtweisen: Die Frankfurter Ethnologin Susanne Schröter gab zu bedenken, dass nicht nur Frauen Opfer patriarchaler Gewalt werden. Andere Opfer, zum Beispiel Kinder, würden durch den Begriff quasi unsichtbar. Der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof, Thomas Fischer, sagte, dass man sicher die Ursachen für solche Taten gesellschaftspolitisch zwar aufarbeiten müsse, der Begriff Femizid aber zu unspezifisch sei.
Das Unspezifische ist es auch, was die Bundesregierung nach eigenen Angaben bislang davon abgehalten hat, von Femiziden zu sprechen. Doch das könnte sich laut Wahlprogramm der SPD bald ändern. Darin heißt es wörtlich: „Wir werden Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Femizide einrichten – also zur Verfolgung von Morden an Frauen, die begangen wurden, weil sie Frauen sind – und setzen uns gesellschaftlich dafür ein, dass Femizide auch als solche benannt werden und nicht als „Verbrechen aus Leidenschaft“ oder „Familientragödie“.
Christoph Klemp